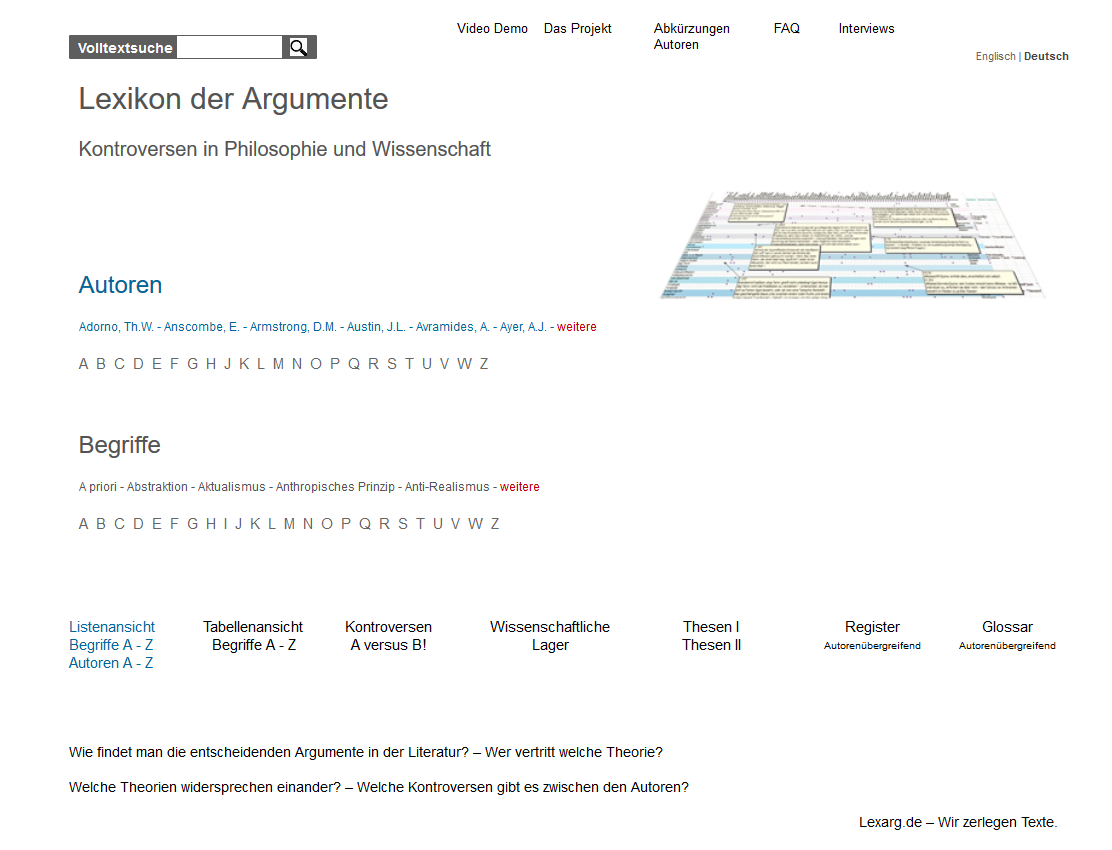Wirtschaft Lexikon der ArgumenteHome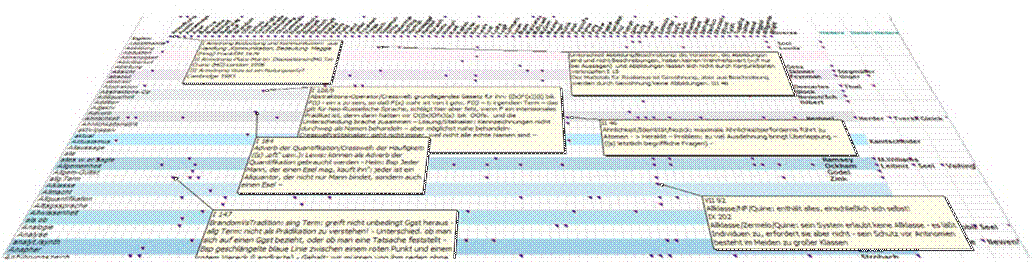
| |||
|
| |||
| Balance of power: Das "Gleichgewicht der Kräfte" bezieht sich auf einen Zustand des Gleichgewichts zwischen konkurrierenden Nationen oder Einheiten, der verhindert, dass eine einzelne Nation andere dominiert. Es umfasst strategische Allianzen, Diplomatie und militärische Fähigkeiten, um Aggressionen zu verhindern und die Stabilität in den internationalen Beziehungen zu wahren. Siehe auch Internationale Beziehungen, Außenpolitik._____________Anmerkung: Die obigen Begriffscharakterisierungen verstehen sich weder als Definitionen noch als erschöpfende Problemdarstellungen. Sie sollen lediglich den Zugang zu den unten angefügten Quellen erleichtern. - Lexikon der Argumente. | |||
| Autor | Begriff | Zusammenfassung/Zitate | Quellen |
|---|---|---|---|
|
Kenneth N. Waltz über Balance of Power – Lexikon der Argumente
Brocker I 634 Balance of Power/WaltzVsTradition/Waltz: Die zentrale Annahme einer Balance-of-Power-Theorie ist, dass Staaten einheitliche Akteure (“unitary actors”) sind, deren Minimalziel das eigene Überleben und deren Maximalziel die universelle Dominanz ist. Dazu haben Staaten zwei Machtmittel: interne Machtsteigerung, (Aufrüstung, Stärkung der Volkswirtschaft) oder externe Machtsteigerung (Allianzenbildung oder Eroberung). Da externe Machtsteigerung ein System von mindestens drei Staaten erfordert, geht die traditionelle Theorie von mindestens drei Akteuren aus. >Macht. WaltzVs: Diese Annahme ist falsch(1). Zwei oder mehr Staaten koexistieren in einem Selbsthilfesystem ohne übergeordnete Zentralgewalt, die einem schwachen Staat zu Hilfe eilen oder einen Staat von dem Einsatz von Machtmittel abhalten kann, die dieser zur Verfolgen seiner Interessen einsetzen könnte. In einem solchen System ist das zu erwartende Resultat ein Gleichgewicht (balance of power). >Gleichgewicht. Dabei ist das primäre Ziel von Staaten nach Waltz, ihre Position im internationalen System beizubehalten(2). Daher werden sie ein Ausbalancieren der Mächte einem Angleichen an stärkere Staaten („bandwagoning“) vorziehen. Waltz These: Dies gilt nicht nur für die Beziehung zwischen Großmächten, sondern für jede Konstellation von zwei Staaten im Wettbewerb. >Wettbewerb. WaltzVsTradition/WaltzVsMorgenthau: ältere Autoren (u. a. Hans J. Morgenthau) hatten einen Willen staatlicher Akteure zur Schaffung von Gleichgewichtssystemen angenommen, Waltz hält dies für überflüssig. (3) Waltz: nicht die Motive der Akteure, sondern die Systemstruktur sorgt dafür, dass Gleichgewicht eintritt.(4) >H.J. Morgenthau. 1. Kenneth N. Waltz, „Theory of International Relations“, in: Fred Greenstein/Nelson W. Polsby (Hg.) International Politics: Handbook of Political Science, Reading, Mas. 1975, S. 36 2. Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, Reading, Mas. 1979, S. 126. 3. Hans J. Morgenthau, Macht und Frieden. Grundlegung einer Theorie der internationalen Politik, Gütersloh 1963, S. 219-220. 3. Waltz 1979, S. 128. Carlo Masala, „Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics” in: Manfred Brocker (Hg.) Geschichte des politischen Denkens. Das 20. Jahrhundert. Frankfurt/M. 2018_____________ Zeichenerklärung: Römische Ziffern geben die Quelle an, arabische Ziffern die Seitenzahl. Die entsprechenden Titel sind rechts unter Metadaten angegeben. ((s)…): Kommentar des Einsenders. Übersetzungen: Lexikon der ArgumenteDer Hinweis [Begriff/Autor], [Autor1]Vs[Autor2] bzw. [Autor]Vs[Begriff] bzw. "Problem:"/"Lösung", "alt:"/"neu:" und "These:" ist eine Hinzufügung des Lexikons der Argumente. |
PolWaltz I Kenneth N. Waltz Man,the State and War New York 1959 Brocker I Manfred Brocker Geschichte des politischen Denkens. Das 20. Jahrhundert Frankfurt/M. 2018 |
||
> Gegenargumente gegen Waltz
> Gegenargumente zu Balance of Power