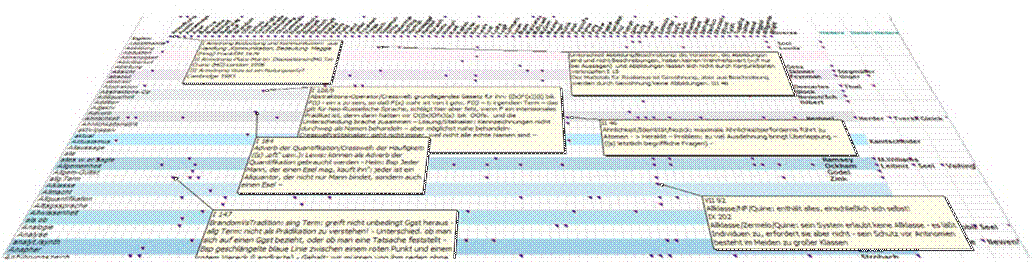Finden Sie Gegenargumente, in dem Sie NameVs…. oder….VsName eingeben.
| Begriff/ Autor/Ismus |
Autor Vs Autor |
Eintrag |
Literatur |
|---|---|---|---|
| Abgeschlossen Kausal | Cartwright Vs Maxwell J.C. | I 4 Erklärung/Wahrheit/van Fraassen/Cartwright: provokante Frage: (The Scientific Image): „Was hat Erklärungskraft mit Wahrheit zu tun?“ Herausforderung/Fraassen: man sollte zeigen, daß wenn x y erklärt und y wahr ist, daß dann x auch wahr sein sollte. Cartwright: das trifft wohl zu im Fall von Kausalen Erklärungen, aber nur dann! I 5 Und diese Art von Erklärung greift nur dann, wenn der Prozeß gerade vonstatten geht! Bsp Radiometer: (Abgeschlossener Glasbehälter mit Windmühlenflügeln, eine Seite schwarz, eine weiß , William Crookes 1853). Wenn Licht auf den Behälter fällt, drehen sich die Flügel. These 1: Lichtdruck. (Vs: das stellte sich als nicht hinreichend heraus). These 2: Drehung durch Bewegung der Gasmoleküle im Behälter. MaxwellVs: die Moleküle bewegen sich in alle Richtungen. Lösung/Maxwell: statt dessen: verschiedene Wärme produziert ungeordneten (tangentialen) Zug, der das Gas an der Oberfläche entlangziehen läßt. (...). I 6 CartwrightVsMaxwell: er gebraucht als fundamentale Gesetze die Boltzmann-Gleichung und die Kontinuitäts-Gleichung, an die ich beide nicht glaube. I 154 CartwrightVsMaxwell: das Medium, das er beschreibt, ist bloß ein Modell, es existiert nirgendwo in einem Radiometer. |
Car I N. Cartwright How the laws of physics lie Oxford New York 1983 CartwrightR I R. Cartwright A Neglected Theory of Truth. Philosophical Essays, Cambridge/MA pp. 71-93 In Theories of Truth, Paul Horwich Aldershot 1994 CartwrightR II R. Cartwright Ontology and the theory of meaning Chicago 1954 |
| Abgeschlossen Kausal | Stalnaker Vs Modaler Realismus | Stalnaker I 36 Proposition/Abgeschlossenheit/Stalnaker: was auch immer Propositionen sind, wenn es welche gibt, gibt es auch Mengen von ihnen. Und für jede Menge von Propositionen ist es definitiv wahr oder falsch, dass alle ihre Elemente wahr sind. Und dies ist natürlich wieder eine Proposition. (W5) Abgeschlossenheits-Bedingung: Für jede Menge von Propositionen G gibt es eine Proposition A so dass G A impliziert und A impliziert jedes Element von G. Stalnaker: d.h. ist, dass für jede Menge von Propositionen es eine Proposition gibt die sagt, dass jede Proposition in der Menge wahr ist. Also nehme ich an, dass der Welt-Geschichten-Theoretiker (W5) zu seiner Theorie hinzufügen will. (W6) Äquivalente Propositionen sind identisch. Problem: die Probleme von (W6) sind bekannt. ((s) > Hyperintensionalismus/ Hyperintensionalität): Sätze, die in denselben Welten wahr sind, sind ununterscheidbar, VsMöWe-Semantik, Vs Semantik möglicher Welten). I 40 Modaler Realismus/MR/Lewis/Stalnaker: nach Lewis ist die aktuale Welt (WiWe) nur ein echter Teil einer Realität, die aus vielen Paralleluniversen besteht, die räumlich und zeitlich voneinander getrennt sind. Aktuale Welt/WiWe/Lewis/Stalnaker: ist dann indexikalisch definiert als der Teil, der mit uns in Verbindung steht. unverwirklichte Möglichkeiten/Possibilia/Lewis/Stalnaker: existiert dann tatsächlich, aber in einem anderen Teil der Realität. Ihre Nicht-Aktualität besteht nur in ihrer Lokalisierung woanders. ((s) das ist nur eine polemische Darstellung: Lokalisierung muss mehr sein als „woanders“. Lokalisierung kann von uns gar nicht vorgenommen werden für Gegenden, die überhaupt nicht mit uns in Verbindung stehen, weil wir dann kein Wissen haben.) modaler Realismus/Stalnaker: teilt sich in 1. semantische These: Behauptungen über das was möglich und notwendig ist, sollten analysiert werden in Begriffen darüber was wahr ist in einigen oder allen Teilen der Realität 2. metaphysische These:: über die Existenz von möglichen Welten (MöWe). Semantischer MR/Stalnaker: Problem: VsMR man könnte einwenden, dass es gar nicht möglich ist die metaphysischen Tatsachen über ihn zu wissen, selbst wenn der semantische Teil wahr wäre. I 41 Lewis: hier gibt es eine Parallele zu Benacerrafs Dilemma über mathematische Wahrheit und Wissen. (>Mathematik/Benacerraf, Referenz/Benacerraf, Mathematische Entitäten/Benacerraf.) I 42 EpistemologieVsMR/Stalnaker: die Vertreter des epistemologischen Arguments gegen den MR weisen die Parallele zwischen mathematischen Objekten und realistisch aufgefasst Possibilia zurück. Sie bestehen darauf, dass Referenz und Wissen von konkreten Dingen kausale Verbindung erfordert, selbst wenn das nicht für abstrakte Dinge (Zahlen usw.) gilt. Wissen/LewisVs: warum sollte die Grenze zwischen dem, was für Wissen und Referenz eine Kausale Verbindung benötigt getroffen werden in Begriffen der Unterscheidung abstrakt/konkret? Wissen/Lewis: stattdessen sollten wir sagen, dass Referenz und Wissen von kontingenten Tatsachen Kausale Verbindung erfordert, nicht aber das von modaler Realität (Wissen darüber was was möglich und notwendig ist). Modaler Realismus/Wissen/Lewis: These: im Kontext des MR können wir sagen, dass indexikalisches Wissen Kausale Verbindung benötigt, unpersönliches Wissen aber nicht. I 43 Platonismus/Mathematik/Stalnaker: pro Lewis: hier muss Wissen nicht auf einer kausalen Verbindung beruhen. Dann kann Benacerrafs Dilemma gelöst werden. EpistemologieVsMR/Stalnaker: ich fühle aber immer noch die Kraft des epistemologischen Arguments VsMR. Referenz/Wissen/Stalnaker: Problem: den Unterschied zwischen Wissen und Referenz auf Zahlen, Mengen usw. und auf Kohlköpfe usw. zu erklären. I 49 Mögliche Welten/MöWe/MR/Vsmodaler Realismus/Wissen/Verifikationismus/StalnakerVsLewis: der modale Realist kann keine verifikationistischen Prinzipien für das, was er sein Wissen nennt, anführen. Fazit: Problem: der MR kann nicht auf der einen Seite sagen, dass MöWe Dinge von derselben Art sind wie die wirkliche Welt (kontingente physikalische Objekte) und auf der anderen Seite sagen, MöWe seien Dinge, von denen wir auf dieselbe Art wissen, wie von Zahlen, Mengen Funktionen. ((s) Letztere sind nicht „wirkliche“ Dinge). |
Stalnaker I R. Stalnaker Ways a World may be Oxford New York 2003 |
| Abgeschlossen Kausal | Verschiedene Vs Quantenmechanik | Kanitscheider II 108 QuantenchemieVsQuantenmechanik: Schwachpunkt der orthodoxen QM: v. Neumanns traditionelle Hilbertraumformulierung (1929) ist beschränkt auf abgeschlossene Systeme mit endlich vielen Freiheitsgraden, was die Vernachlässigung der Umgebung des Quantensystems bedeutet. Hennig Genz Gedankenexperimente, Weinheim 1999 VIII 208 Vollständigkeit/Quantenmechanik/QM: die QM ist in dem Sinne vollständig, dass über die Orte der Teilchen nicht mehr gesagt werden kann, als dies die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der QM zulassen. Problem: wie kann es sein, dass Gretels erfolglose Suche nicht nur die Realität erschafft, dass es sich nicht bei ihr befindet, sondern instantan auch die, dass es in Hänsels Gebiet anzutreffen ist? Einstein-Podoski-Rosen/EPR: das ist unmöglich! Sie kann nicht instantan die Realität in dem entfernten Gebiet schaffen. Die Realität muss bereits vor dem ersten Experiment bestanden haben. EPRVsQM: unvollständig, da sie die bereits bestehenden Realitäten nicht berücksichtigt. Statt dessen brauchen wir eine Theorie, die real, lokal und Kausal ist. Sie sollte nur Eigenschaften von meßbaren physikalischen Objekten betreffen. John Gribbin Schrödingers Kätzchen Frankfurt/M 1998 III 135 Quantenelektrodynamik/QED: (bestbestätigte Theorie aller Zeiten) gibt AufSchluss über die Wechselwirkung von Elektronen mit elektromagnetischer Strahlung. Sie erklärt alles außer der Gravitation und dem Verhalten von Atomkernen, (z.B. radioaktiver Zerfall). III 137 Feynman: wir müssen uns nur um drei Dinge kümmern: 1. Die Wahrscheinlichkeit ,mit der sich ein Photon von einem Ort zum andern bewegt. 2. Wahrscheinlichkeit, mit der ein Elektron den Ort wechselt, 3. die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Photon von einem Elektron absorbiert oder emittiert wird. III 138 Feynman erkannte, dass wir jeden möglichen Weg berücksichtigen müssen (Abb III 138) Lauter Verschlingungen auf dem Weg von A nach B. (Feynman-Diagramme). Beim Doppelspaltexperiment addierten wir die Wahrscheinlichkeiten, mit denen das Licht je eine der Spalten passierte. III 139 Feynman: warum nicht mehr Schlitze in den Schirm schneiden, bis es schließlich gar kein Hindernis mehr gibt, da sich nun sämtliche "Schlitze" überlappen. Da nun der Schirm verschwunden ist, müssen wir sämtliche Wahrscheinlichkeiten aller möglichen Wege addieren. Für die komplizierten Wege sind die Wahrscheinlichkeiten sehr klein und heben sich normalerweise auf. Dass sich ihr Einfluss dennoch bemerkbar macht, zeigte Feynman mit einem Spiegel! III 140 Das Licht wählt den zeitsparendsten Weg. III 141 Gribbin: es geschieht tatsächlich, dass das Licht gleichzeitig in einem anderen, flacheren Winkel weiterreist, andere Photonen treffen senkrecht auf das Auge... Dass wir das nicht beobachten, liegt allein daran, dass die Wege in der Nachbarschaft des kürzesten Weges einerseits wahrscheinlicher sind, und sich andererseits wechselseitig verstärken. Doch damit ist die Geschichte nicht zu Ende! III 142 Messungen zeigen, dass tatsächlich reflektierte Photonen von der weit entfernten Ecke des Spiegels eintreffen, obwohl sie sich aufheben! III 142/143 Obwohl sich benachbarte Teile der Spiegelecke aufheben, lassen sich immer noch Spiegelstreifen finden, an denen sich die Wahrscheinlichkeiten addieren. Wie groß der Abstand zwischen den Streifen sein muss, hängt von der Wellenlänge des Lichts ab: das ist eine schöne Bestätigung des Welle Teilchen Dualismus, da wir das Licht ja hier als Photonen betrachten. (Beugungsgitter). III 145 Auf ähnliche Weise lassen sich sämtliche optischen Phänomene als Addition von Wahrscheinlichkeiten deuten, u.a. Linsen, Beugung und Verlangsamung des Lichts beim Eintritt in Wasser, Poissons Fleck, Doppelspaltexperiment. III 150 VsQuanten-Eletrodynamik/VsQED: sie ist nicht völlig makellos: Schwierigkeit beim Ortswechsel eines Elektrons: sie zöge eine endlose Addition von Wahrscheinlichkeiten nach sich, die Ergebnisse wüchsen ins Unendliche, das wäre Unsinn. III 145 Def Magnetisches Moment des Elektrons: Maß für die Wechselwirkung eines Elektrons mit einem magnetischen Feld. III 147 Natur/Physik/Feynman: "Die gewaltige Vielfalt der Natur ist aus der monotonen Wiederholung der Kombination von nur drei Grundvorgängen ableitbar."(s.o.) III 148 Feynman-Diagramm: bizarr: zwei Elektronen treten durch Austausch eines Photons in Wechselwirkung, doch dürfen wir genausogut sagen, das zweite Elektron emittiere das Photon "in der Zukunft" und dieses gehe in der Zeit rückwärts, so dass es vom ersten Elektron "in der Vergangenheit" absorbiert wird. Ein Elektron kann sich bekanntlich in ein Teilchenpaar mit Positron verwandeln. Die entsprechenden Gleichungen sind wie üblich, symmetrisch. III 149 Feynman erkannte nun, dass man die ganze Wechselwirkung mit Bezug auf ein einzelnes Elektron beschreiben kann: ein Elektron bewegt sich von einem Ort zum andern und wechselwirkt mit einem energiereichen Photon. Durch diese Wechselwirkung wird das Elektron rückwärts in der Zeit geschickt, bis es mit einem anderen energiereichen Photon wechselwirkt, dabei "umgedreht" wird und wieder in die Zukunft reist. An beiden Wechselwirkungen scheinen drei Dinge im Spiel zu sein: Positron, Elektron, Photon. Ähnlich wie wenn ein Lichtstrahl von einem Spiegel abprallt: zwei Lichtstrahlen, die den passenden Winkel bilden, und der Spiegel selbst. Analogie: Doch wie es in Wirklichkeit nur einen in den Raum zurückgeworfenen Lichtstrahl gibt, so existiert auch nur ein Elektron. Photonen können für Elektronen als "Zeitspiegel" fungieren. Def Renormierung: Methode, sich der Unendlichen zu entledigen. Man teilt beide Seiten der Gleichung durch Unendlich. Feynman: "Verrückt". Hennig Genz Gedankenexperimente, Weinheim 1999 VII 275 Renormierung: muss leider auch auf das Vakuum angewendet werden, da die QED uns sagt, dass hier die Energiedichte unendlich ist. Bezieht man die RT mit ein, wird die Situation noch schlimmer: es gibt immer noch unendliche Größen, aber sie können nicht mehr renormiert werden. Twistor Theorie/Penrose: Versuch, sowohl die Teilchen als auch die weiten leeren Strecken innerhalb eines Gegenstands mit derselben Theorie zu erklären. Messen/Längeneinheit: eine universelle Längeneinheit erhält man, wenn man die Gravitationskonstante, die Plancksche Konstante und die Lichtgeschwindigkeit kombiniert: "Quantum der Länge". VII 276 Plancksche Länge/Planck-Länge. etwa 10 35. Ebenso Planck Zeit, usw. Es ist sinnlos, von einer Zeit oder Länge zu reden, die kleiner ist. Quantenschaum/Wheeler: Quantenfluktuationen in der Geometrie des Raums sind auf der Ebene der Atome, ja selbst der Teilchen völlig vernachlässigbar, aber auf dieser ganz fundamentalen Ebene kann man sich den Raum selbst als einen Schaum von Quantenfluktuationen vorstellen. >Twistor Theorie/Penrose: These: dann könnte man sich vorstellen, dass sämtliche Materieteilchen nicht mehr sind als getwistete Fragmente des leeren Raums. |
Kanitsch I B. Kanitscheider Kosmologie Stuttgart 1991 Kanitsch II B. Kanitscheider Im Innern der Natur Darmstadt 1996 |
Der gesuchte Begriff oder Autor findet sich in folgenden Thesen von Autoren des zentralen Fachgebiets.
| Begriff/ Autor/Ismus |
Autor |
Eintrag |
Literatur |
|---|---|---|---|
| Farbforscherin | Jackson, F. | Metzinger II 259 Frank Jackson: "Knowledge Argument" - "Argument des Unvollständigen Wissens": Bsp Farbenforscherin Mary wächst in einem Abgeschlossenen Raum auf, einziger Kontakt zur Außenwelt ist ein Schwarz-Weiß-Monitor. Sie lernt alles über Farben, aber nicht, "wie es ist" Farben zu sehen. These dadurch, daß sie freigelassen wird und zum ersten Mal Farben sieht, erwirbt sie neues Wissen. VsJackson: die Mehrzahl der Autoren argumentiert, dass das Argument nicht zu dem intendierten Resultat des Existenz nicht-physikalischer Tatsachen führe. Problem: wie der Wissenszuwachs überhaupt zu beschreiben wäre. Nida-RümelinVsNagel: These: die Formulierung "Wie es ist" verfehlt den Kern. II 265 Nida-Rümelin: es läßt sich aus allen diesen Fällen oder Beispielen nicht ableiten, dass eine Qualia-Vertauschung bei funktionaler Übereinstimmung möglich wäre. II 275 Wissen/Glauben/Nida-Rümelin: bei phänomenalem Wissen handelt es sich um Wissen im strengen Sinne: nämlich, um Wissen über etwas, das der Fall ist. II 280 Argument des unvollständigen Wissens/Jackson: sollte in der ursprünglichen Fassung zeigen, dass es nicht-physikalische Tatsachen gibt, d.h. solche Tatsachen, die in physikalistischem Vokabular nicht formuliert werden können. Pauen I 179 Farbenforscherin Mary/Jackson/Pauen: JacksonVsMonismus - These 1. Neurobiologisches Wissen ist im Hinblick auf phänomenale Erfahrungen prinzipiell unvollständig - 2. Der Monismus ist falsch, phänomenale Eigenschaften können nicht identisch mit neuronalen Eigenschaften sein! Phänomenale Eigenschaften sind kausal wirkungslose Nebeneffekte mentaler Zustände - Epiphänomenalismus. |
Pauen I M. Pauen Grundprobleme der Philosophie des Geistes Frankfurt 2001 |