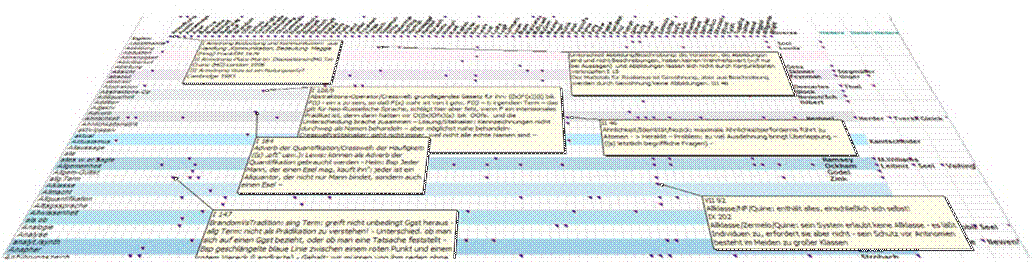Finden Sie Gegenargumente, in dem Sie NameVs…. oder….VsName eingeben.
| Begriff/ Autor/Ismus |
Autor Vs Autor |
Eintrag |
Literatur |
|---|---|---|---|
| Käfer Wittgenstein | Stalnaker Vs Nagel, Th. | I 20 Objektives Selbst/Nagel/Stalnaker: Nagel beginnt mit dem Ausdruck eines allgemeinen Gefühls der Verwirrung über den eigenen Platz in einer unpersönlichen Welt. Ich: wenn jemand sagt "Ich bin RS" scheint es, dass die Person eine Tatsache darstellt. I 21 Pointe: es ist eine objektive Tatsache, ob eine solche Feststellung wahr oder falsch ist, unabhängig davon, was der Sprecher denkt. Problem: unser Begriff der objektiven Welt scheint gar keinen Platz für eine solche Tatsache zu lassen! Eine vollständige Darstellung der Welt wie sie in sich selbst ist, wird keine bestimmte Person als mich herausgreifen. Sie wird mir nicht sagen, wer ich bin. Semantische Diagnose: versucht eine Darstellung von Index-Wörtern oder Selbst-Lokalisierung als Lösung. NagelVsSemantische Diagnose: das trifft nicht den Kern der Sache. StalnakerVsNagel: eine bestimmte Variante kann unser spezielles Problem hier lösen, aber es bleiben viele andere in Bezug auf die Relation zwischen einer Person und der Welt die sie bewohnt, und zwar darüber, was genau die subjektiven Tatsachen über die Erfahrung uns sagen, wie die Welt in sich selbst ist. Selbst-Identifikation/Selbst-Lokalisation/Glauben/Stalnaker: nichts könnte einfacher sein: Wenn EA am 5. Juni 1953 sagt "Ich bin ein Philosoph" dann ist das wahr, gdw. EA am 5 Juni 1953 ein Philosoph ist. Problem: was ist der Inhalt der Aussage? Inhalt/Wahrheitsbedingungen/WB/Selbst-Identifikation/Ich/Stalnaker: der Inhalt, die Information wird nicht durch die WB erfasst, wenn die WB zeitlos und unpersönlich gemacht werden. ((s) Die Wahrheitsbedingungen bei Selbstidentifikation oder Selbst-Lokalisation sind nicht homophon! D.h. sie sind ich die Wiederholung von „Ich bin krank“, sondern sie müssen um Ort, Datum und Angaben über die Person ergänzt werden damit werden sie zeitlos und wahrheitsfähig. Problem/Stalnaker: der Sprecher könnte geglaubt haben was er sagt, ohne das Datum und den Ort selbst überhaupt zu kennen oder seine Zuhörer könnten die Äußerung verstanden haben, ohne das Datum usw. zu kennen. Lösung: die semantische Diagnose braucht eine Darstellung des subjektiven oder kontextuellen Inhalts. Nagel: ist sich jedenfalls sicher, dass er die umgekehrte Lösung ablehnt: eine ontologische Sicht die die Selbst-.Eigenschaften objektiviert. Stalnaker: das wäre so etwas wie die Behauptung, dass jeder von uns eine bestimmte irreduzible Selbst-Eigenschaft hat, mit der er bekannt ist. ((s) >Käfer-Beispiel, Wittgenstein dito), versuchsweise nehme ich an, dass das in der Objektivierung des phänomenalen Charakters der Erfahrung exemplifiziert werden könnte. I 253 Selbst/Thomas Nagel/Stalnaker: Nagel findet es verwunderlich, dass ausgerechnet er von allen Thomas Nagel sein muss. Selbst/subjektiv/objektiv/Stalnaker: allgemeines Problem: den Standpunkt einer Person in einer nichtzentrierten Vorstellung einer objektiven Welt unterzubringen. Es ist nicht klar, wie man diese Relation darstellen soll. Selbst/Ich/Nagel/Stalnaker: Bsp "Ich bin TN". Problem: es ist nicht klar, wieso unsere Welt Raum für solche Tatsachen hat. Dilemma: a) solche Tatsachen müssen existieren, weil Dinge sonst unvollständig wären b) sie können nicht existieren, denn so wie die Dinge sind, enthalten sie solche Tatsachen nicht. (Nagel 1986, 57). Selbst/semantische Diagnose/Nagel/Stalnaker: NagelVsSemantische Diagnose: unbefriedigend: NagelVsOntologische Lösung: will die objektive, zentrumslose Welt auf falsche Weise anreichern. Nagel: Mittelposition These: es gibt ein objektives Selbst. StalnakerVsNagel: das ist schwer zu fassen und weder notwendig noch hilfreich. I 254 Semantische Diagnose/StalnakerVsNagel: hat mehr Potential als Nagel annimmt. Mein Plan ist: 1. semantische Diagnose 2. Skizze einer metaphysischen Lösung 3. objektives Selbst ist ein Fehler 4. allgemeines Problem subjektiver Standpunkte 5. kontext-abhängige oder subjektive Information - einfache Lösung für qualitative Erlebnisse. Selbst/subjektiv/objektiv/semantische Diagnose/Nagel/Stalnaker: (in Stalnakers Version): Dazu gehört nicht, dass "Ich bin TN" angeblich ohne Inhalt ist. StalnakerVsNagel: die Identität der ersten Person ist nicht "automatisch und daher uninteressant". semantische Diagnose: beginnt mit den Wahrheitsbedingungen (WB). WB: "Ich bin F" geäußert von XY ist wahr, gdw. XY F ist. Was für eine Information wird damit übermittelt? I 255 Inhalt/Information/Selbst/Identität/Stalnaker: eine Lösung: wenn folgendes stimmt: Glaube/Überzeugung/Stalnaker: sind Mengen von nichtzentrierten MöWe Inhalt/Selbstzuschreibung/Stalnaker: ist dann Menge von zentrierten MöWe. Bsp Ich bin TN ist wahr gdw. es durch TN geäußert wird, Inhalt: wird repräsentiert durch die Menge der zentrierten MöWe die TN als ihr ausgezeichnetes Objekt haben. Inhalt/Überzeugung/Lewis/Stalnaker: mit Lewis kann man Glaubensinhalte auch als Eigenschaften auffassen. (Lewis 1979). I 257 Semantische Diagnose/NagelVsSemantische Diagnose/Stalnaker: "Sie macht nicht, dass das Problem weggeht". Stalnaker: was ist denn nun das Problem? Problem/Nagel: eine adäquate Lösung müsste die subjektiven und die objektiven Begriffe in Harmonie bringen. I 258 StalnakerVsNagel: dazu muss man aber die Quellen des Problems besser artikulieren als Nagel es tut. Analogie. Bsp Angenommen, ein allzu einfach gestrickter Skeptiker sagt: "Wissen impliziert Wahrheit, also kann man nur notwendige Wahrheiten wissen". Vs: das ist eine Verwechslung verschiedener Reichweiten der Modalität. VsVs: der Skeptiker könnte dann antworten "Diese Diagnose ist unbefriedigend, weil sie nicht macht, dass das Problem weggeht". Problem/Stalnaker: allgemein: ein Problem kann sich als raffinierter herausstellen, aber auch dann kann es bloß ein linguistischer Trick sein. Illusion/Erklärung/Problem/Stalnaker: es reicht nicht zu erkennen, dass an der Wurzel des Problems eine Illusion besteht. Einige Illusionen sind hartnäckig, wir fühlen ihr Bestehen sogar noch nachdem sie erklärt sind. Aber das impliziert wiederum nicht, dass es ein Problem ist. I 259 Warum-Fragen/Stalnaker: Bsp „Warum sollte es möglich sein, dass...“ (z.B. dass physikalische Gehirnzustände Qualia hervorrufen). Solche Fragen haben nur Sinn, wenn es eher wahrscheinlich ist, dass das Zugrundeliegende nicht möglich ist. I 260 Selbsttäuschung/Gedächtnisverlust/Selbst/Irrtum/Stalnaker: Bsp Angenommen, TN täuscht sich darüber, wer er ist, dann weiß er nicht, dass TN selbst die Eigenschaft hat, TN zu sein, obwohl er weißt, dass TN die Selbst-Eigenschaft von TN hat! (Er weiß ja nicht, dass er selbst TN ist). Er weiß nicht, dass er die Eigenschaft hat, die er „ich sein“ nennt. ((s) „Ich sein“ ist hier nur auf TN zu beziehen, nicht auf jeden beliebigen Sprecher). objektiv/nichtzentrierte Welt/Selbst/Stalnaker: das ist eine Tatsache über die objektive, nichtzentrierte Welt, und wenn er sie kennt, weiß er, wer er ist. So sagt der Vertreter der ontologischen Sicht. Ontologische Sicht/StalnakerVsNagel/StalnakerVsVs: die Strategie ist interessant: zuerst wird das Selbst objektiviert – indem selbst-lokalisierende Eigenschaften in Merkmale der nichtzentrierten Welt verwandelt werden. Dann versucht man, den wesentlich subjektiven Charakter durch die subjektive Fähigkeit es Erfassens zu erhalten. I 263 Nagel: These: weil die objektive Vorstellung ein Subjekt hat, gibt es auch seine mögliche Präsenz in der Welt und das erlaubt mir, subjektive und objektive Sicht zusammenzubringen. StalnakerVsNagel: ich sehe nicht, wie das daraus folgt. Warum soll daraus, dass ich mir eine mögliche Situation vorstellen kann folgen, dass ich darin sein könnte?. Fiktion: hier gibt es sowohl den teilnehmenden Erzähler als auch den Erzähler von außerhalb, allwissend oder nicht. I 264 Semantische Diagnose/Stalnaker: mag hinreichend sein für normale Selbst-Lokalisierung. Aber Nagel will mehr: einen philosophischen Gedanken. StalnakerVsNagel: ich glaube nicht, dass an einem philosophischen Gedanken hier mehr dran ist, als an dem normalen. Vielleicht ist es eine andere Einstellung (Haltung) aber das verlangt keinen Unterschied im Inhalt! Subjektiver Inhalt/Stalnaker: (so wie er von der semantischen Diagnose identifiziert wird) scheint mir ein plausibler Kandidat zu sein. |
Stalnaker I R. Stalnaker Ways a World may be Oxford New York 2003 |
| Käfer Wittgenstein | Stalnaker Vs Shoemaker, S. | I 19 Qualia/vertauschte Spektren/Shoemaker/Stalnaker: versucht, die Erkennbarkeit vertauschter Spektren mit einer funktionalistischen und materialistischen Theorie des Geistes zu versöhnen. Dabei geht es um die Relation zwischen Bewusstsein und Repräsentation - zwischen dem intentionalen und dem qualitativen Inhalt einer Erfahrung. StalnakerVsShoemaker: ich verteidige die altmodische Sicht, dass Vergleiche des qualitativen Charakters der Erfahrung zwischen Personen bedeutungslos (meaningless) sind ((s) >Wittgenstein, Käfer-Beispiel). Qualia/Stalnaker: es geht nicht darum, sie zu eliminieren (zu “quinieren"), sondern These sie als plausiblen und verständlichen Teil einer rein relationalen Struktur anzunehmen. These: Die Vergleichbarkeit ist deswegen möglich, weil unser Begriff des qualitativen Charakters begrifflich mit dem repräsentationalen Inhalt verknüpft ist. I 235 Shoemakers Paradox/Stalnaker: ist die ganze Geschichte kohärent? Könnten α und β so "verschieden kombiniert" werden? Lösung/Stalnaker: der Widerspruch könnte auf zwei Weisen vermieden werden: man könnte a) die Identitätsaussage 5 zurückweisen b) die Identitätsaussagen 1-4. Ad a): führt weg vom Funktionalismus zu einem rein physikalistischen Ansatz für Qualia, Subjektive Unterscheidbarkeit ist dann kein Kriterium mehr. Phänomenale Erfahrungen können systematisch gleich aussehen, während sie es überhaupt nicht sind. Diese Sichtweise würde eine Entscheidung darüber nötig machen, auf welcher Allgemeinheitsebene man physikalische Typen definieren will. Und es ist nicht klar, auf welcher Basis man das entscheiden sollte. I 236 Problem: dafür müsste man Qualia wahrscheinlich mit sehr feinkörnig unterschiedenen physikalischen Eigenschaften identifizieren. Diese könnten sich in Details unterscheiden, die für uns überhaupt nicht wahrnehmbar sind. Bsp die physiologische Entwicklung im Gehirn während des Alterns in einer Person würde zu anderen Wahrnehmungen führen, die für die Person subjektiv aber die gleichen Wahrnehmungen blieben! ((s) Unterscheidung ohne Unterschied). Ad b): (Identitätsaussagen 1-4 zurückweisen): das ist Shoemakers Position. Shoemaker: These: die Hinzufügung des Backup-Systems beeinflusst den qualitativen Charakter, denn es ändert die Gedächtnismechanismen, die konstitutiv sind für die Identitätsbedingungen für Qualia. Dann unterscheiden sich Bsp (s.o.) Alices und Berthas qualitative Erfahrungen. Stalnaker: entspricht das der common sense-Sicht? StalnakerVsShoemaker: Problem: spätere Veränderungen im Wahrnehmungs- aber auch im Gedächtnis-System einer Person, aber auch kontrafaktische unrealisierte Möglichkeiten würden den qualitativen Charakter der Erfahrungen einer Person verändern. Bsp Angenommen, Bertha hat ein flexibles Gehirn, wenn ein Teil beschädigt ist, übernimmt ein anderer Teil die Arbeit. Alice: ihr Gehirn ist weniger flexibel, bei einer Beschädigung ändert sich der qualitative Charakter ihrer Wahrnehmungen. StalnakerVsShoemaker: Problem: selbst wenn die zentralen Realisierungen dieselben sind und selbst wenn die Beschädigungen niemals auftreten, würde es scheinen, dass Shoemakers Antwort impliziert, dass die Qualia anders wären, wegen der verschiedenen Verbindungen mit potentiellen alternativen Realisierungen der Erfahrungen. Diese Unterschieden mögen rein intrapersonell sein: Angenommen Alice hatte früher ein ebenso flexibles Gehirn wie Bertha, aber mit zunehmendem Alter verlor sie ihre Flexibilität: Shoemaker scheint zu implizieren, dass der qualitative Charakter von Alice’ Farberlebnissen sich mit den Veränderungen der Potentialität ihres Gehirns verändert, selbst wenn es der Introspektion unzugänglich ist. |
Stalnaker I R. Stalnaker Ways a World may be Oxford New York 2003 |
| Käfer Wittgenstein | Hintikka Vs Stegmüller, W. | Wittgenstein I 273 Sprache/Welt/Sprachspiel/Wittgenstein/Hintikka: nach der beliebten Auffassung (u.a. Stegmüller 1975, 584) unterlässt es Wittgenstein in seiner Spätphilosophie zu zeigen, inwieweit die Sprache unmittelbar mit der Wirklichkeit verknüpft ist. Stegmüller: These: wir sollten nicht auf die Bedeutung unserer Ausdrücke achten, sondern auf die Weise, in der diese gebraucht werden. Hintikka: nach dieser (angeblich Wittgensteinschen) Auffassung kommt es nicht auf die "vertikalen" Verbindungen an, durch die unsere Wörter mit Gegenständen und unsere Sätze mit Tatsachen verknüpft sind, sondern auf "horizontale" Verbindungen zwischen verschiedenen Zügen im Rahmen unserer Sprachspiele. Damit unterstellt man Wittgenstein, das Verstehen der Sprache sei nichts anderes als das Verstehen der Rolle, die verschiedene Arten von Äußerungen unter verschiedenen Umständen in unserem Leben spielen.(Vs: Verstehen der Sprache = Verstehen der Rolle, die sie spielt) HintikkaVsStegmüller: aus dieser Interpretation würde sich ergeben, dass nach Wittgenstein nicht einmal die gewöhnliche deskriptive Bedeutung auf Wahrheitsbedingungen basiert. Nach ihr wären Behauptbarkeits und Rechtfertigungsbedingungen ein mögliches Wittgensteinisches Gegenstück zu den Wahrheitsbedingungen. Dann wäre eine Aussage nicht dann berechtigt, wenn ihr eine Tatsache entspricht, sondern wenn ihre Behauptung durch die Rolle in unseren sprachbezogenen Tätigkeiten letztlich durch ihre Rolle in unserem Leben gerechtfertigt ist. I 274 HintikkaVsStegmüller: der späte Wittgenstein ist weit davon entfernt, die vertikalen Beziehungen zwischen Sprache und Wirklichkeit abzuschaffen. Er hebt sie vielmehr hervor! Die wichtigste Funktion der Sprachspiele (wenn auch nicht die einzige) ist es, diese Aufgabe zu erfüllen. I 279 ff Gebrauchstheorie/Wittgenstein/HintikkaVsStegmüller: in der (hier kritisierten) "eingebürgerten" Auffassung "X"(Stegmüller u.a.) habe Wittgenstein es irgendwann aufgegeben, Fragen über Bedeutung zu stellen, und untersuche statt dessen den Gebrauch. Variante: nach einer Unterlesart Xa ist unter Gebrauch das Sprachspiel zu verstehen, das die "logische Heimat" dieses Ausdrucks ist. Dies ist jedoch nicht die Lesart, die von der "eingebürgerten" Lesart X" vorausgesetzt wird. Mehrere Facetten: nach X versteht Wittgenstein unter dem Gebrauch eines Ausdrucks etwas, das vom üblichen hergebrachten Sprachgebrauch nicht sonderlich verschieden ist. I 280 Gebrauchstheorie/Wittgenstein/Hintikka: entspricht das aber Wittgenstein? In der berühmten Gleichsetzung von Gebrauch und Bedeutung bedient sich Wittgenstein eines Wortes, das im wesentlichen zwei Bedeutungen hat: denn Gebrauch a) kann dazu dienen das Übliche, Hergebrachte zu betonen, andererseits b) signalisieren, dass es um die Nutzanwendung einer Sache geht (wie "Gebrauchsanweisung") Das steht in Einklang mit Wittgensteins Vergleich der Wörter mit Werkzeugen und spricht im hohen Maße für die neue Interpretation. Wittgenstein spricht auch von "Verwendung" und "Anwendung". "Unter Anwendung verstehe ich das, was die Lautverbindungen oder Striche überhaupt zu einer Sprache macht. "Man kann die Beschreibung des Gebrauchs abkürzen indem man sagt, diese Wort bezeichne den Gegenstand." Hintikka: diente der Gebrauch nicht als Verbindung zwischen Sprache und Welt, ließe er sich nicht in dieser Weise abkürzen. HintikkaVsStegmüller: der Irrtum ist, Sprachspiele als vorwiegend innersprachliche (verbale) Spiele aufzufassen, d.h. Spiele, deren Züge typischerweise in Sprechakten bestehen. Zug/Sprachspiel/Hintikka: dagegen bestehen die "Züge" der hier befürworteten Interpretation aus Übergängen, in denen Äußerungen zwar eine Rolle spielen, können, aber normalerweise nicht die einzige Rolle. Im Gegenteil, viele Züge brauchen gar keine sprachlichen Äußerungen zu beinhalten. X/Terminologie/Hintikka: wir wollen X den "Irrtum der verbalen Sprachspiele" nennen. Vor diesem Irrtum warnt Wittgenstein schon in seiner Erläuterung des Ausdrucks "Sprachspiel": "Das Wort soll hier hervorheben, dass das Sprechen der Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit oder einer Lebensform". I 281 Hintikka: nach X wäre das Sprechen der Sprache nicht ein Teil des Sprachspiels sondern es wäre schon das ganze Sprachspiel. Beleg: in "Über Gewissheit" werden offenbar Sprachspiele dem Reden gegenübergestellt: "Unsere Rede erhält durch unsere übrigen Handlungen ihren Sinn." Wittgenstein I 314/315 Bsp Käfer in der Schachtel. PU § 293. "Das Ding in der Schachtel gehört überhaupt nicht zum Sprachspiel, auch nicht einmal als ein Etwas. Durch dieses Ding in der Schachtel kann gekürzt werden. Es hebt sich weg, was immer es ist." Stegmüller: (laut Hintikka): behauptet, dass Wittgenstein überhaupt die Existenz privater Erlebnisse bestreitet. Hintikka: falls wir recht haben, ist die eingebürgerte Auffassung nicht nur falsch, sondern diametral falsch: Privatsprache/HintikkaVsStegmüller: der Wechsel von der phänomenologischen zur physikalischen Sprache tastet den ontologischen Status der phänomenologischen Gegenstände - einschließlich der privaten Erlebnisse - gar nicht an! Die Welt in der wir leben bleibt für uns die Welt der phänomenologischen Gegenstände, doch wir müssen über sie in der gleichen Sprache reden, in der wir über physische Gegenstände sprechen. |
Hintikka I Jaakko Hintikka Merrill B. Hintikka Untersuchungen zu Wittgenstein Frankfurt 1996 Hintikka II Jaakko Hintikka Merrill B. Hintikka The Logic of Epistemology and the Epistemology of Logic Dordrecht 1989 W II L. Wittgenstein Vorlesungen 1930-35 Frankfurt 1989 W III L. Wittgenstein Das Blaue Buch - Eine Philosophische Betrachtung Frankfurt 1984 W IV L. Wittgenstein Tractatus logico-philosophicus Frankfurt/M 1960 |
| Käfer Wittgenstein | Newen Vs Wittgenstein | New I 94 Gegenstand/Ding/Objekt/Tractatus/Wittgenstein/Newen: die Frage, welcher art die Gegenstände des Tractatus sind, ist bis heute umstritten: 1. James Griffin: einfache physikalische Teilchen 2. Hintikka: Punkte im Gesichtsfeld 3. H. Ishiguro: Exemplifikationen nicht weiter zurückführbarer Eigenschaften 4. Peter Carruthers: Alltagsgegenstände. Gegenstand/Tractatus/NewenVsTractatus/NewenVsWittgenstein/Newen: es gibt hier widersprüchliche Prinzipien, von denen eins aufgegeben werden muss, I 95 Damit die gegenstandsebene bestimmt werden kann: (i) Elementarsätze haben die Form "Fa", "Rab"… es werden externe Eigenschaften zugeschrieben. (ii) externe und interne Eigenschaften verhalten sich zueinander wie verschiedene Dimensionen Bsp Längen und Farben. (iii) Elementarsätze sind logisch unabhängig. Problem: dann kann der Wahrheitswert eines Satzes "Ga" von dem eines Satzes "Fa" abhängen. Bsp ein Punkt kann nicht zugleich rot und blau sein. Pointe: dann sind die Sätze aber nicht mehr unabhängig. Wittgenstein/VsWittgenstein/Selbstkritik/Newen: Wittgenstein selbst bemerkte das 1929 im Aufsatz Some remarks on Logical Form. I 98 Elementarsatz/Tractatus/Wittgenstein/Newen: Sätze über Punkte im Gesichtsfeld oder physikalische Teilchen sind dort keine Elementarsätze, weil sie nicht unabhängig sein können ((s) Widersprechende Eigenschaften müssen ausgeschlossen werden können). I 99 Mittlerer Wittgenstein: erkennt in der Abhängigkeit eine Grundstruktur, die nicht beseitigt werden kann. Bsp "Was blau ist, ist nicht rot". Satzbedeutung/PU/Wittgenstein/Newen: die Bedeutung von Sätzen kann also nicht nur durch die Vertretungsrelation von Namen gewährleistet sein. Abbildtheorie/WittgensteinVsWittgenstein/Selbstkritik/Wittgenstein/Newen: die AT muss also revidiert werden. 100 mittlerer Wittgenstein/Newen. These: die Bedeutung von Zeichen wird durch die syntaktischen regeln seines Sprachsystems festgelegt. VsWittgenstein/Newen: die Frage, wie diese syntaktischen Regeln festgelegt sind, wird hier noch nicht beantwortet. NS I 35 Regelfolgen/Wittgenstein: ist, einer Gepflogenheit gemäß zu handeln. Ohne Begründung oder Überlegung. Es ist schlicht eine Kompetenz, auf eine erlernte, übliche und selbstverständliche Weise zu handeln. Gepflogenheiten/Konvention: Gepflogenheiten sind nicht deshalb gültig, weil sie festgesetzt oder vereinbart wurden, sondern weil sich üblicherweise alle daran gebunden fühlen. Das gilt auch für regeln, die die Bedeutung eines sprachlichen Zeichens festlegen. ((s) Regeln/(s): legen also etwas fest, sind aber selbst nicht festgelegt, sondern eingespielt und stabil.) NS I 36 VsWittgenstein/Newen/Schrenk: Problem: die Unbestimmtheit der Verwendungsweisen. Es gibt auch Fehlverwendungen, die als bedeutungskonstituierend einbezogen werden müssten. Sie können sehr verbreitet sein. VsWittgenstein/Newen/Schrenk: Problem: Holismus der Gebrauchsweisen: wenn eine einzige neue Verwendungsweise eingeführt wird, müsste sich die Bedeutung des Ausdrucks ändern. NS I 37 Käfer-Bsp/Privatsprache/Wittgenstein/Newen/Schrenk: der Ausdruck „Käfer“ kann eine klare Verwendung haben, selbst wenn jeder einen anderen Käfer in seiner Schachtel und selbst, wenn die Schachtel leer ist! Wittgenstein: selbst wenn sich das Ding fortwährend veränderte. Das Ding in der Schachtel gehört überhaupt nicht zum Sprachspiel. Auch nie einmal als ein Etwas. (§ 293). Newen/Schrenk. das zeigt, dass die Bedeutung eines Ausdrucks nicht dadurch festgelegt wird, dass wir eine Empfindung haben, sondern durch die Praxis in einer Gemeinschaft. Eine Person allein kann Ausdrücken keine Bedeutung verleihen. NS I 38 Newen/Schrenk VsWittgenstein: Bsp Robinson kann aber durch eine Regelmäßigkeit der Beschaffenheit Wörter für Ananas usw. einführen. WittgensteinVsVs/Newen/Schrenk: würde einwenden, 1. dass Robinson keine Gepflogenheiten etablieren kann, weil er nicht merken würde, wenn er davon abweicht. Dann gäbe es keinen Unterschied mehr zwischen folgen und zu folgen glauben. VsVs/Newen/Schrenk: 2. ein weiterer Einwand wäre, dass Robinson nur Kategorien bilden kann, weil er in seiner Gemeinschaft gelernt hat, wie man Kategorien bildet. |
New II Albert Newen Analytische Philosophie zur Einführung Hamburg 2005 Newen I Albert Newen Markus Schrenk Einführung in die Sprachphilosophie Darmstadt 2008 |