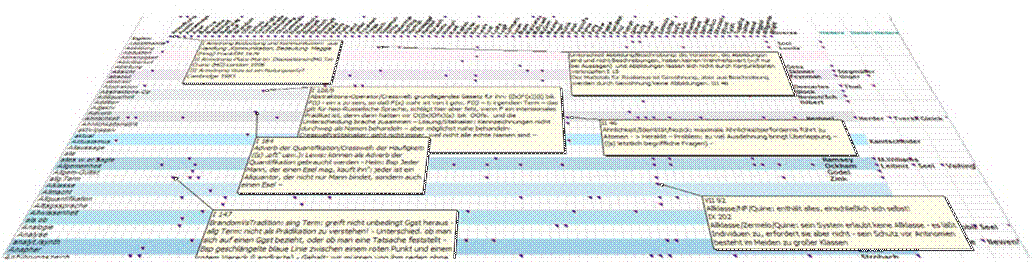Finden Sie Gegenargumente, in dem Sie NameVs…. oder….VsName eingeben.
| Begriff/ Autor/Ismus |
Autor Vs Autor |
Eintrag |
Literatur |
|---|---|---|---|
| Kompetenz Sprache | Harman Vs Chomsky, N. | I 306 Kompetenz/Performanz/HarmanVsChomsky: Kompetenz als "Wissen daß die Sprache durch Regeln der Grammatik beschrieben wird". Und daß "Grammatik diese Kompetenz spezifiziert". ChomskyVsHarman: das habe ich nicht nur nie behauptet, sondern auch mehrfach öffentlich zurückgewiesen. Es wäre auch absurd, wenn der Sprecher die Regeln explizit kennen müßte. Wissen/Sprache/Harman: a) Wissen daß, b) Wissen wie. Da Sprache offensichtlich kein "Wissen, daß" ist, muß es "Wissen, wie" sein. Der Sprecher weiß, "wie er andere Sprecher zu verstehen hat". Analog zur Fähigkeit des Fahrradfahrers. I 307 ChomskyVsHarman: er gebraucht "Kompetenz" ganz anders als ich. Ich sehe keine Beziehung zur "Fähigkeit des Fahrradfahrers", keine "Menge von Gewohnheiten" oder etwas derartiges. I 308 HarmanVsChomsky: das internalisierte System (das die Auswahl der Grammatiken beschränkt) muß in einer grundlegenderen Sprache" dargestellt werden, und das Kind muß letztere bereits verstanden haben muß, ehe es diesen Schematismus anwenden kann. a) das führt zu einem Zirkel: würde man sagen, daß das Kind die "grundlegendere Sprache" "direkt" , ohne sie gelernt zu haben, beherrscht, warum sagt man dann nicht auch, daß es die eigentliche Sprache "direkt" , ohne sie zu lernen, beherrscht. Oder: b) Regreß: sagt man dagegen, daß es die grundlegendere Sprache erst lernen muß, dann stellt sich die Frage, wie diese grundlegende Sprache selbst gelernt wird, ChomskyVsHarman: selbst wenn man annimmt, daß der Schematismus an einer "angeborenen Sprache" dargestellt sein muß, folgt nicht das, was Harman sieht: Das Kind muß vielleicht die "grundlegendere Sprache" beherrschen, aber es muß sie nicht "sprechen und verstehen". Wir müssen nur annehmen, daß es davon Gebrauch machen kann. ad a): die Annahme ist falsch, daß das Kind seine MutterSprache beherrscht, ohne sie zu lernen. Es wird nicht mit perfekten Deutschkenntnissen geboren. Andererseits spricht nichts gegen die Annahme, daß es mit perfekten Kenntnissen einer universalen Grammatik geboren wird. HarmanVsChomsky: in einem Modell kann erst dann aus gegebenen Daten auf eine Grammatik geschlossen werden, wenn in dem Modell bereits detaillierte Informationen über eine Theorie der Performanz enthalten sind. Chomsky: interessant, aber nicht zwingend. I 310 Empirie/Theorie/HarmanVsChomsky: nennt Chomskys Strategie "erfinderischen Empirismus", eine Doktrin, die "Induktionsprinzipien" verwendet. Solcher "erfindungsreichen Empirismus" sei sicher nicht zu widerlegen, "ganz gleich, wie die sprachlichen Daten aussehen". ChomskyVsHarman: Empirismus ist nicht so wichtig. Mich interessiert die Frage, ob es "Ideen und Prinzipien verschiedener Art" gibt, die die "Form der erworbenen Kenntnis auf weitgehend festgelegte und hochorganisierte Weise determinieren" (Rationalistische Variante) oder ob andererseits "die Struktur des Aneignungsmechanismus auf einfache und periphere Verarbeitungsmechanismen beschränkt ist..." (empiristische Variante). Es ist historisch gerechtfertigt und heuristisch sinnvoll, das auseinanderzuhalten. |
Harman I G. Harman Moral Relativism and Moral Objectivity 1995 Harman II Gilbert Harman "Metaphysical Realism and Moral Relativism: Reflections on Hilary Putnam’s Reason, Truth and History" The Journal of Philosophy, 79 (1982) pp. 568-75 In Theories of Truth, Paul Horwich Aldershot 1994 |
| Kompetenz Sprache | Putnam Vs Chomsky, N. | Chomsky I 293 PutnamVsChomsky: Putnam nimmt für die Phonetik in der universalen Grammatik an, dass sie lediglich eine einzige Liste von Lauten hat. Das erfordere keine ausgefeilte Erklärungshypothese. Nur "Gedächtnisspanne und Erinnerungsvermögen". "Kein aufrechter Behaviorist würde leugnen, dass dies angeborene Eigenschaften sind". ChomskyVsPutnam: es sind aber sehr starke empirische Hypothesen über die Auswahl der universellen distinktiven Merkmale aufgestellt worden, von denen offenbar keine auf der Grundlage von Beschränkungen des Gedächtnisses erklärt werden kann. Chomsky I 298 PutnamVsChomsky: These statt eines angeborenen Schematismus könnte man "generelle Mehrzweck Strategien" annehmen. Diese angeborene Basis müsste für den Erwerb jedweden Wissens die gleiche sein, sodass nichts Besonderes am Spracherwerb ist. Chomsky I 299 ChomskyVsPutnam: damit ist er nicht mehr zur Annahme von etwas Angeborenem berechtigt. Außerdem verschiebt es das Problem nur. PutnamVsChomsky: die in der universalen Grammatik vorgeschlagenen Bewertungsfunktionen "wird die Art von Fakten konstituiert, die die Lerntheorie zu erklären versucht, nicht aber die gesuchte Erklärung selbst". ChomskyVsPutnam: Bsp niemand würde sagen, daß die genetische Basis für die Entwicklung von Armen statt Flügeln "die Art von Tatsache ist, die die Lerntheorie zu erklären versucht". Vielmehr sind sie die Grundlage für eine Erklärung anderer Fakten des menschlichen Verhaltens. Ob die Bewertungsfunktion erlernt wird oder die Grundlage des Lernen ist, ist eine empirische Frage. PutnamVsChomsky: bestimmte Mehrdeutigkeiten können erst durch Routine entdeckt werden, daher ist ihre postulierte Erklärung durch Chomskys Grammatik nicht so beeindruckend. ChomskyVsPutnam: das mißversteht er, in Wirklichkeit bezieht sich das auf Kompetenz und nicht auf Performanz (tatsächliche Praxis). Was die Grammatik erklärt ist, warum Bsp in "die Kritik der Studenten" "Studenten" als Subjekt oder Objekt verstanden werden kann, während Bsp "Korn" in "das Wachsen des Korns" nur Subjekt sein kann. Die Frage der Routine spielt hier gar keine Rolle. Chomsky I 300 angeborene Ideen/ChomskyVsPutnam: die angeborene Repräsentation der universalen Grammatik löst das Problem des Lernens tatsächlich (zumindest zum Teil) wenn es wirklich stimmt, daß diese die Basis für den Spracherwerb darstellt, was sehr wohl der Fall sein kann! III 87 Putnam/Chomsky: Putnam schlägt vor: Korrektheit in der Linguistik ist, was sie gegenwärtig verfügbaren Daten über das Verhalten des Sprechers, unter einem gegenwärtigen Interesse am besten erklären. Was heute richtig ist, wird morgen falsch sein. PutnamVsChomsky: ich habe nie behauptet, was heute richtig ist, wird morgen falsch sein. Putnam: Chomskys verborgene Hauptthesen: 1. das es uns freisteht, unsere Interessen nach Belieben zu wählen, 2. dass Interessen ihrerseits keiner normativen Kritik unterliegen. Bsp der Herzanfall von Hans liegt in der Missachtung der ärztlichen Gebote. Andere Erklärung: hoher Blutdruck. Es kann sein, dass tatsächlich an einem Tag mehr das eine, am andern Tag mehr das andere Faktum im Interesse des Sprechers legt. III 88 PutnamVsChomsky: 1. unsere Interessen können wir uns nicht einfach aussuchen. 2. es kommt mitunter vor, dass die Relevanz eines bestimmten Interesses umstritten ist. Wie kommt es jedoch, dass einige Interessen vernünftiger sind als andere? Vernünftigkeit sei in verschiedenen Zusammenhängen von verschiedenen Bedingungen abhängig. Es gibt keine allgemeingültige Antwort. III 88/89 Die Behauptung, ein Begriff sei interessenrelativ, läuft nicht auf das Gleiche hinaus wie die These, alle Interessen seien in gleichem Maße vernünftig. |
Putnam I Hilary Putnam Von einem Realistischen Standpunkt In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Frankfurt 1993 Putnam I (a) Hilary Putnam Explanation and Reference, In: Glenn Pearce & Patrick Maynard (eds.), Conceptual Change. D. Reidel. pp. 196--214 (1973) In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (b) Hilary Putnam Language and Reality, in: Mind, Language and Reality: Philosophical Papers, Volume 2. Cambridge University Press. pp. 272-90 (1995 In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (c) Hilary Putnam What is Realism? in: Proceedings of the Aristotelian Society 76 (1975):pp. 177 - 194. In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (d) Hilary Putnam Models and Reality, Journal of Symbolic Logic 45 (3), 1980:pp. 464-482. In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (e) Hilary Putnam Reference and Truth In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (f) Hilary Putnam How to Be an Internal Realist and a Transcendental Idealist (at the Same Time) in: R. Haller/W. Grassl (eds): Sprache, Logik und Philosophie, Akten des 4. Internationalen Wittgenstein-Symposiums, 1979 In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (g) Hilary Putnam Why there isn’t a ready-made world, Synthese 51 (2):205--228 (1982) In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (h) Hilary Putnam Pourqui les Philosophes? in: A: Jacob (ed.) L’Encyclopédie PHilosophieque Universelle, Paris 1986 In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (i) Hilary Putnam Realism with a Human Face, Cambridge/MA 1990 In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (k) Hilary Putnam "Irrealism and Deconstruction", 6. Giford Lecture, St. Andrews 1990, in: H. Putnam, Renewing Philosophy (The Gifford Lectures), Cambridge/MA 1992, pp. 108-133 In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam II Hilary Putnam Repräsentation und Realität Frankfurt 1999 Putnam III Hilary Putnam Für eine Erneuerung der Philosophie Stuttgart 1997 Putnam IV Hilary Putnam "Minds and Machines", in: Sidney Hook (ed.) Dimensions of Mind, New York 1960, pp. 138-164 In Künstliche Intelligenz, Walther Ch. Zimmerli/Stefan Wolf Stuttgart 1994 Putnam V Hilary Putnam Vernunft, Wahrheit und Geschichte Frankfurt 1990 Putnam VI Hilary Putnam "Realism and Reason", Proceedings of the American Philosophical Association (1976) pp. 483-98 In Truth and Meaning, Paul Horwich Aldershot 1994 Putnam VII Hilary Putnam "A Defense of Internal Realism" in: James Conant (ed.)Realism with a Human Face, Cambridge/MA 1990 pp. 30-43 In Theories of Truth, Paul Horwich Aldershot 1994 SocPut I Robert D. Putnam Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community New York 2000 Chomsky I Noam Chomsky "Linguistics and Philosophy", in: Language and Philosophy, (Ed) Sidney Hook New York 1969 pp. 51-94 In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Chomsky II Noam Chomsky "Some empirical assumptions in modern philosophy of language" in: Philosophy, Science, and Method, Essays in Honor of E. Nagel (Eds. S. Morgenbesser, P. Suppes and M- White) New York 1969, pp. 260-285 In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Chomsky IV N. Chomsky Aspekte der Syntaxtheorie Frankfurt 1978 Chomsky V N. Chomsky Language and Mind Cambridge 2006 |
| Kompetenz Sprache | Searle Vs Chomsky, N. | SearleVsChomsky: Chomsky ging einen Schritt zu weit: er hätte leugnen sollen, dass das Sprachorgan überhaupt eine Struktur hat, die sich als Automat beschreiben lässt. So hat er sich der analytischen Technik ausgeliefert. Dennett I 555 Sprache/SearleVsChomsky: Man kann den Spracherwerb so erklären: es gibt tatsächlich eine angeborene Spracherwerbsvorrichtung. Es wird aber der Hardware-Erklärung nichts hinzugefügt, wenn man tief unbewußte universalgrammatische Regeln annimmt. Das steigert nicht den Vorhersagewert. Es gibt die nackten, blinden neurophysiologischen Vorgänge und es gibt Bewusstsein,. Darüber hinaus gibt es nichts. ((s) sonst Regress durch Zwischeninstanzen). Searle I 273 SearleVsChomsky: für die Universalgrammatik gibt es eine viel einfachere Hypothese: Es gibt tatsächlich eine Spracherwerbsvorrichtung. Sie bringt Einschränkungen mit sich, welche Sprachtypen für den Menschen erlernbar sind. Und es gibt eine funktionale Erklärungsebene, welche Sprachtypen das Kleinkind erlernen kann, wenn es diesen Mechanismus anwendet. Durch unbewusste Regeln wird der Erklärungswert keineswegs gesteigert. IV 9 SearleVsChomsky/SearleVsRyle: es gibt weder alternative Tiefenstrukturen noch bedarf es spezieller Konversationspotulate. IV 204 Sprechakttheorie/SearleVsChomsky: oft wird im Anschluss an Chomsky gesagt, die Sprache müsse endlich vielen Regeln gehorchen (für unendlich viele Formen). IV 205 Das ist irreführend, und war nachteilig für die Forschung. Besser ist dieses Bild: Zweck der Sprache ist die Kommunikation. Deren Einheit ist der illokutionäre Sprechakt. Es geht darum, wie wir von Lauten zu den Akten gelangen. VIII 411 Grammatik/Sprache/Chomsky/Searle: Chomskys Schüler, (von Searle "Jungtürken" genannt) verfolgen Chomskys Ansatz radikaler über Chomsky hinaus. (s.u.). Aspekte der Syntaxtheorie/Chomsky: (reifes Werk, 1965 (1)) ambitiösere Ziele als bisher: Erklärung aller sprachlichen Beziehungen zwischen dem Lautsystem und dem Bedeutungssystem. VIII 412 Dazu muss die Grammatik aus drei Teilen bestehen: 1. syntaktische Komponente, die die interne Struktur der unendlichen Anzahl von Sätzen beschreibt, (Herz der Grammatik) 2. phonologische Komponente: Lautstruktur. (rein interpretativ) 3. semantische Komponente. (rein interpretativ),. Auch der Strukturalismus verfügt über Phrasenstrukturregeln. VIII 414 Dabei wird nicht behauptet, dass ein Sprecher einen derartigen Prozess der Anwendung von Regeln (z.B. "Ersetze x durch y") tatsächlich bewusst oder unbewusst durchläuft. Das anzunehmen wäre eine Verwechslung von Kompetenz und Performanz. SearleVsChomsky: Hauptproblem: es ist noch nicht klar, wie die vom Grammatiker gelieferte Theorie der Konstruktion von Sätzen genau die Fähigkeit des Sprechers repräsentieren und in genau welchem Sinn von "kennen" der Sprecher die Regeln kennen soll. VIII 420 Sprache/Chomsky/Searle: Chomskys Auffassung der Sprache ist exzentrisch! Entgegen der common sense Auffassung diene sie nicht zur Kommunikation! Statt dessen nur allgemeine Funktion, die Gedanken des Menschen auszudrücken. VIII 421 Falls Sprache doch eine Funktion hat, so gibt es dennoch keinen signifikanten Zusammenhang mit ihrer Struktur! These: die syntaktischen Strukturen sind angeboren und besitzen keinen signifikanten Zusammenhang mit Kommunikation, obwohl man sie natürlich zur Kommunikation verwendet. Das Wesentliche an der Sprache ist ihre Struktur. Bsp Die "BienenSprache" ist überhaupt keine Sprache, da sie nicht die richtige Struktur besitzt. Pointe: wenn der Mensch eines Tages zu einer Kommunikation mit ganz anderen syntaktischen Formen käme, besäße er keine Sprache mehr, sondern irgendetwas anderes! Generative Semantik/"Jungtürken"VsChomsky: einer der entscheidenden Faktoren bei der Bildung syntaktischer Strukturen ist die Semantik. Selbst Begriffe wie "grammatisch korrekt" oder "wohlgeformter Satz" verlangen die Einführung semantischer Begriffe! Bsp "Er nannte ihn einen Republikaner und beleidigte ihn". ChomskyVsJungtürken: Scheinstreit, die Kritiker haben die Theorie lediglich in einer neuen Terminologie reformuliert. VIII 422 Jungtürken: Ross, Postal, Lakoff, McCawley, Fillmore. These: die Grammatik beginnt mit einer Beschreibung der Bedeutung eines Satzes. Searle: wenn die Generative Semantik recht hat und es keine syntaktischen Tiefenstrukturen gibt, wird die Linguistik erst recht interessant, wir können dann systematisch untersuchen, wie Form und Funktion zusammenhängen. (Chomsky: hier gibt es keinen Zusammenhang!). VIII 426 angeborene Ideen/Descartes/SearleVsChomsky: Descartes hat zwar die Idee eines Dreiecks oder der Vollkommenheit als angeboren angesehen, aber von Syntax natürlicher Sprache hat er nichts behauptet. Er scheint ganz im Gegenteil angenommen zu haben, dass Sprache willkürlich ist: er nahm an, dass wir unseren Ideen willkürlich Wörter beilegen! Begriffe sind für Descartes angeboren, Sprache nicht. Unbewusstes: ist bei Descartes nicht zugelassen! VIII 429 Bedeutungstheorie/BT/SearleVsChomsky/SearleVsQuine: die meisten Bedeutungstheorien begehen denselben Fehlschluss: Dilemma: a) entweder die Analyse der Bedeutung enthält selbst einige zentrale Elemente des zu analysierenden Begriffs, zirkulär. ((s) > McDowell/PeacockeVs: Verwechslung Erwähnung/Gebrauch; >Erwähnung, >Gebrauch). b) die Analyse führt den Gegenstand auf kleinere Elemente zurück, denen seine entscheidenden Merkmale abgehen, dann ist sie unbrauchbar, weil sie inadäquat ist! SearleVsChomsky: Chomskys generative Grammatik begeht denselben Fehlschluss: wie man von der syntaktischen Komponente der Grammatik erwartet, dass sie die syntaktische Kompetenz des Sprechers beschreibt. Die semantische Komponente besteht aus einer Menge von Regeln, die die Bedeutungen der Sätze bestimmen, und setzt dabei sicherlich richtig voraus, dass die Bedeutung eines Satzes von der Bedeutung seiner Elemente sowie von deren syntaktischer Kombination abhängt. VIII 432 Dasselbe Dilemma: a) Bei den verschiedenen Lesarten mehrdeutiger Sätze handelt es sich lediglich um Paraphrasen, dann ist die Analyse zirkulär. Bsp Eine Theorie, die die Kompetenz erklären will, darf nicht zwei Paraphrasen von "Ich ging zur Bank" anführen, weil die Fähigkeit, die Paraphrasen zu verstehen, genau die Kompetenz voraussetzt, die sie erklären will! Ich kann die generelle Kompetenz, Deutsch zu sprechen nicht dadurch erklären, dass ich einen deutschen Satz in einen anderen deutschen Satz übersetze! b) Die Lesarten bestehen nur aus Listen von Elementen, dann ist die Analyse inadäquat: sie kann nicht erklären, dass der Satz eine Behauptung ausdrückt. VIII 433 ad a) VsVs: es wird behauptet, dass die Paraphrasen lediglich illustrativen Zweck hätten und nicht wirklich Lesarten seien. SearleVs: doch was können die wirklichen Lesarten sein? Bsp Angenommen, wir könnten die Lesarten als Steinhaufen interpretieren: für einen sinnlosen Satz gar keine, für einen analytischen Satz wird die Anordnung im Prädikat Haufen in dem Subjekthaufen enthalten sein usw. Nichts in den formalen Eigenschaften der semantischen Komponente könnte uns davon abhalten, aber statt einer Erklärung der Beziehungen zwischen Laut und Bedeutung ieferte die Theorie eine nicht erklärte Beziehung zwischen Lauten und Steinen. VsVs: wir könnten die wirklichen Lesarten in einem zukünftigen universalen semantischen Alphabet ausgedrückt finden. Die Elemente stehen dann für die Bedeutungseinheiten in allen Sprachen. SearleVs: dasselbe Dilemma: a) Entweder ist das Alphabet eine Art neuer künstlicher Sprache und die Lesarten wiederum Paraphrasen, nur diesmal in Esperanto oder b) Die Lesarten in dem semantischen Alphabet sind lediglich eine Liste von Merkmalen der Sprache. Die Analyse ist inadäquat, weil sie einen Sprechakt durch eine Liste von Elementen ersetzt. VIII 434 SearleVsChomsky: der semantische Teil seiner Grammatik kann nicht erklären, was denn der Sprecher eigentlich erkennt, wenn er eine der semantischen Eigenschaften erkennt. Dilemma: entweder steriler Formalismus oder uninterpretierte Liste. Sprechakttheorie/SearleVsChomsky: Lösung: Sprechakte haben zwei Eigenschaften, deren Kombination uns aus dem Dilemma entlässt: sie sind regelgeleitet und intentional. Wer einen Satz wörtlich meint, äußert ihn in Übereinstimmung mit gewissen semantischen Regeln und mit der Intention, seien Äußerung gerade durch die Berufung auf diese Regeln zum Vollzug eines bestimmten Sprechakts zu machen. VIII 436 Bedeutung/Sprache/SearleVsChomsky: es gibt keine Möglichkeit, die Bedeutung eines Satzes ohne Berücksichtigung seiner kommunikativen Rolle zu erklären. VIII 437 Kompetenz/Performanz/SearleVsChomsky: seine Unterscheidung ist verfehlt: er nimmt anscheinend an, dass eine Theorie der Sprechakte eher eine Theorie der Performanz als eine der Kompetenz sein muss. Er sieht nicht, dass Kompetenz letztlich Performanz Kompetenz ist. ChomskyVsSprechakttheorie: Chomsky scheint hinter der Sprechakttheorie den Behaviorismus zu argwöhnen. 1. Noam Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge 1965 |
Searle I John R. Searle Die Wiederentdeckung des Geistes Frankfurt 1996 Searle II John R. Searle Intentionalität Frankfurt 1991 Searle III John R. Searle Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit Hamburg 1997 Searle IV John R. Searle Ausdruck und Bedeutung Frankfurt 1982 Searle V John R. Searle Sprechakte Frankfurt 1983 Searle VII John R. Searle Behauptungen und Abweichungen In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Searle VIII John R. Searle Chomskys Revolution in der Linguistik In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Searle IX John R. Searle "Animal Minds", in: Midwest Studies in Philosophy 19 (1994) pp. 206-219 In Der Geist der Tiere, D Perler/M. Wild Frankfurt/M. 2005 Dennett I D. Dennett Darwins gefährliches Erbe Hamburg 1997 Dennett II D. Dennett Spielarten des Geistes Gütersloh 1999 Dennett III Daniel Dennett "COG: Steps towards consciousness in robots" In Bewusstein, Thomas Metzinger Paderborn/München/Wien/Zürich 1996 Dennett IV Daniel Dennett "Animal Consciousness. What Matters and Why?", in: D. C. Dennett, Brainchildren. Essays on Designing Minds, Cambridge/MA 1998, pp. 337-350 In Der Geist der Tiere, D Perler/M. Wild Frankfurt/M. 2005 |
| Kompetenz Sprache | Brandom Vs Davidson, D. | I 268 Objektivität/Irrtum: es wird behauptet, daß soziale Praktiken hinreichen, Behauptungen objektiv repräsentationalen Gehalt zu verleihen! Das sind dann objektive Wahrheitsbedingungen. Sogar die gesamte Gemeinschaft kann mit einer diesbezüglichen Beurteilung falsch liegen! Universeller Irrtum nur bei Normen, nicht bei Begriffen möglich,s.o.).LL (BrandomVsDavidson). Davidson: will alles Handeln aus Gründen herleiten. Daher stellen irrationale Handlungen ein Problem für ihn dar.931 BrandomVsDavidson: er hält fälschlich eine globale Bedingung für Absichten für eine lokale, weil er nicht zwischen Festlegung und Berechtigung unterscheidet. I 932 I 383 VsDavidson: es kann sein, daß nur der Kontoführer, (nicht der Handelnde) die praktische Begründung darlegen kann. Auch in solchen Fällen würden die Gründe nicht als Ursachen fungieren. I 383 Außerdem kann man aus den Gründen, die man hat, handeln oder nicht. Davidson: Absichten sind umfassende Urteile im Lichte aller Überzeugungen und Wünsche. I 954 BrandomVsDavidson: unbefriedigend, weil Wünsche und Überzeugungen als unanalysierte Grundbegriffe behandelt werden. Er hat nicht die Praktiken dargelegt, wie solche Gehalte übertragen werden können. BrandomVsDavidson: bei Davidson wird nicht unterschieden zwischen Interpretationen zwischen Sprachen und innerhalb einer Sprache. Die Interpretation bei Davidson verlangt explanatorische Hypothesenbildung und Inferenzen, die von Geräuschen, die ein anderer von sich gibt, ausgehen. Dem wurde zu recht entgegengehalten, daß man, wenn man eine gemeinsame Sprache spricht, nicht Geräusche sondern Bedeutungen hört! Hier geht es um die nötigen SubKompetenzen. I 692 Objektivität begrifflicher Normen: über sie können wir uns nicht nur alle einzeln (jeder) sondern auch alle gemeinsam irren! (Elektron, Masse im Universum). Irrtum über den richtigen Gebrauch. > BrandomVsDavidson: kollektiv falsche Überzeugungen möglich. I 957 Davidson: selbst wenn das Pulver naß gewesen wäre, wäre es ihr doch gelungen, den Finger zu krümmen. So liegt in jeder Handlung etwas, das der Handelnde beabsichtigte und das ihm gelungen ist. I 958 BrandomVsDavidson: unser Ansatz kommt ohne eine solche theoretische Festlgung aus. Berufung auf VURD reicht aus, um das Problem mit dem nervösen Bergsteiger zu lösen (Davidson). Das ist eine konkrete Alternative zu Davidsons Vorschlag der "Verursachung in der richtigen Weise". I 729 Brandom: es spielt keine Rolle, ob die gewöhnlich zuverlässige Fähigkeit im Einzelfall versagt. Wenn ich nach dem Brot greife und den Wein verschütte, braucht es nach unserem Ansatz nichts zu geben, was ich zu tun beabsichtigte, und was mir auch gelang. I 747 Problem: die Substitution im Bereich des "daß" erhält nicht den Wahrheitswert der ganzen Zuschreibung. Lösung: das Satztokening innerhalb des daß-Bereichs gehört nicht zur eigentlichen Zuschreibung! Davidson: Referenz und Wahrheitwert bei Zuschreibung geändert. I 961 BrandomVsDavidson: dieser betrachtet nicht die Möglichkeit, die Beziehung zwischen dem "daß" und dem folgenden Satztokening als eine anaphorische statt als eine demonstrative aufzufassen. II 48 BrandomVsDavidson: Festlegung vor Wunsch! Handlung/BrandomVsDavidson: wir haben woanders angefangen. Drei Unterscheidungen:II 126 a. Intentional handeln: Anerkennen einer praktischen Festlegung b. Mit Gründen handeln: zu einer Festlegung berechtigt sein. c. Aus Gründen handeln: hier sind Gründe Ursachen, wenn die Anerkennung einer Festlegung durch geeignetes Überlegen ausgelöst wird. NS I 166 Referenz/Brandom: ist bei ihm kein fundamentaler Begriff. Er muss sie aber erklären, weil sie dennoch ein zentraler Begriff ist. Lösung/Brandom: Bildung von Äquivalenzklassen von Sätzen, deren Position im Netz von Inferenzen erhalten bleibt, wenn Terme durch koreferentielle Terme ausgetauscht werden. Wahrheit/BrandomVsTarski/BrandomVsDavidson: er muss ihre Definition so umbiegen, dass statt dass die Wahrheit den Folgerungsbegriff („von wahren Prämissen zu wahren Konklusionen“) charakterisiert, umgekehrt der Begriff der Folgerung den der Wahrheit charakterisiert. Dazu betrachtet Brandom die Stellung von Sätzen, die mit „es ist wahr dass,..“ beginnen, in unserem folgerungsvernetzten Sprachspiel betrachtet. |
Bra I R. Brandom Expressive Vernunft Frankfurt 2000 Bra II R. Brandom Begründen und Begreifen Frankfurt 2001 |
| Kompetenz Sprache | Wittgenstein Vs Davidson, D. | Davidson II 84 Davidson/Aristoteles: praktischer Syllogismus, Ursachen sind Gründe - WittgensteinVs: Ursachen nicht empirisch sondern durch Sprachkompetenz erkennbar. II 85 Alle Argumente dieser Art gehen davon aus, daß zwischen Grund und Handlung eine derart enge logisch-konzeptuelle Relation besteht, daß Gründe und Handlungen nicht als zwei distinkte Ereignisse verstanden werden können. Nur als numerisch verschieden könnten sie in einer Ursache-Folge-Beziehung stehen. Das würde jedoch durch die deduktive Relation verhindert. DavidsonVsWittgenstein ("Actions, Reason and Causes") Das ist eine Scheinlösung: Wesentlich für die Relation ist, daß der Handelnde die Handlung ausführt, weil er Gründe hatte. Man kann auch einen Grund haben, ohne aus diesem Grund zu handeln. Was uns interessiert ist der Grund, aus dem der Handelnde x tat, nicht irgendein Grund. solange dieses "weil" nicht erklärt wird, wird die tatsächliche Erklärungsleistung von Erklärungen aus Gründen nicht ausgeschöpft. Dieses Defizit ist nur vermeidbar wenn wir annehmen, daß "Rationalisierung eine Spezies kausaler Erklärung" ist. Dummett I 111 Wende zur Sprache: Wittgensteins Tractatus Grundsatz der analytischen Philosophie: der einzige Weg zur Analyse des Gedankens führt über die Analyse der Sprache. Davidson geht immer von einer Bedeutungstheorie aus, WittgensteinVsDavidson: dagegen vermeidet in seinen Spätschriften die Aufstellung einer allgemeinen Theorie der Bedeutung, da er meint, jeder Versuch einer systematischen Erklärung der Sprache könne gar nicht anders, als verschiedene Phänomene in eine einzige Beschreibungsform zu zwängen: Verzerrung. Aber auch Wittgenstein ist der Meinung, daß das Ziel der Philosophie ist, uns instand zu setzen, durch Übersicht über das Funktionieren der Sprache und damit über die Struktur unserer Gedanken die Welt richtig zu erkennen. |
W II L. Wittgenstein Vorlesungen 1930-35 Frankfurt 1989 W III L. Wittgenstein Das Blaue Buch - Eine Philosophische Betrachtung Frankfurt 1984 W IV L. Wittgenstein Tractatus logico-philosophicus Frankfurt/M 1960 Davidson I D. Davidson Der Mythos des Subjektiven Stuttgart 1993 Davidson I (a) Donald Davidson "Tho Conditions of Thoughts", in: Le Cahier du Collège de Philosophie, Paris 1989, pp. 163-171 In Der Mythos des Subjektiven, Stuttgart 1993 Davidson I (b) Donald Davidson "What is Present to the Mind?" in: J. Brandl/W. Gombocz (eds) The MInd of Donald Davidson, Amsterdam 1989, pp. 3-18 In Der Mythos des Subjektiven, Stuttgart 1993 Davidson I (c) Donald Davidson "Meaning, Truth and Evidence", in: R. Barrett/R. Gibson (eds.) Perspectives on Quine, Cambridge/MA 1990, pp. 68-79 In Der Mythos des Subjektiven, Stuttgart 1993 Davidson I (d) Donald Davidson "Epistemology Externalized", Ms 1989 In Der Mythos des Subjektiven, Stuttgart 1993 Davidson I (e) Donald Davidson "The Myth of the Subjective", in: M. Benedikt/R. Burger (eds.) Bewußtsein, Sprache und die Kunst, Wien 1988, pp. 45-54 In Der Mythos des Subjektiven, Stuttgart 1993 Davidson II Donald Davidson "Reply to Foster" In Truth and Meaning, G. Evans/J. McDowell Oxford 1976 Davidson III D. Davidson Handlung und Ereignis Frankfurt 1990 Davidson IV D. Davidson Wahrheit und Interpretation Frankfurt 1990 Davidson V Donald Davidson "Rational Animals", in: D. Davidson, Subjective, Intersubjective, Objective, Oxford 2001, pp. 95-105 In Der Geist der Tiere, D Perler/M. Wild Frankfurt/M. 2005 Dummett I M. Dummett Ursprünge der analytischen Philosophie Frankfurt 1992 Dummett II Michael Dummett "What ist a Theory of Meaning?" (ii) In Truth and Meaning, G. Evans/J. McDowell Oxford 1976 Dummett III M. Dummett Wahrheit Stuttgart 1982 Dummett III (a) Michael Dummett "Truth" in: Proceedings of the Aristotelian Society 59 (1959) pp.141-162 In Wahrheit, Michael Dummett Stuttgart 1982 Dummett III (b) Michael Dummett "Frege’s Distiction between Sense and Reference", in: M. Dummett, Truth and Other Enigmas, London 1978, pp. 116-144 In Wahrheit, Stuttgart 1982 Dummett III (c) Michael Dummett "What is a Theory of Meaning?" in: S. Guttenplan (ed.) Mind and Language, Oxford 1975, pp. 97-138 In Wahrheit, Michael Dummett Stuttgart 1982 Dummett III (d) Michael Dummett "Bringing About the Past" in: Philosophical Review 73 (1964) pp.338-359 In Wahrheit, Michael Dummett Stuttgart 1982 Dummett III (e) Michael Dummett "Can Analytical Philosophy be Systematic, and Ought it to be?" in: Hegel-Studien, Beiheft 17 (1977) S. 305-326 In Wahrheit, Michael Dummett Stuttgart 1982 |
| Kompetenz Sprache | Putnam Vs Field, H. | Field IV 405 Interner Realismus/metaphysischer/Putnam/Field: (ad Putnam: Vernunft Wahrheit und Geschichte): FieldVsPutnam: der Kontrast zwischen internem Realismus (iR) und metaphysischem Realismus (mR) ist nicht klar genug herausgebracht. >Interner Realismus, >metaphysischer Realismus. Metaphysischer Realismus/Field: umfasst drei Thesen, die Putnam nicht trennt. 1. mR1: These die Welt besteht aus einer Gesamtheit geistunabhängiger Objekte. 2. mR2: These es gibt genau eine wahre und vollständige Beschreibung (Theorie) der Welt. mR2/Field: ist keine Konsequenz des mR1 ((s) ist unabhängig) und ist keine Theorie, die irgendein metaphysischer Realist überhaupt vertreten sollte. Beschreibung/Welt/FieldVsPutnam: wie könnte es überhaupt nur eine einzige Beschreibung der Welt ((s) oder von überhaupt etwas) geben? Die Begriffe, die wir gebrauchen sind niemals unvermeidlich; Wesen die ganz anders als wir sind, könnten Prädikate mit anderen Extensionen gebrauchen, und diese könnten in unserer Sprache völlig undefinierbar sein. Field IV 406 Warum sollte eine solche fremde Beschreibung „dieselbe Beschreibung“ sein? Vielleicht gibt es eine sehr abstrakte Charakterisierung, die das erlaubt, aber die haben wir noch nicht. falsche Lösung: man kann auch nicht sagen, es gebe eine einzige Beschreibung, die unsere eigenen Begriffe gebraucht. Unsere jetzigen Begriffe könnten nicht hinreichend sein für eine Beschreibung der „vollständigen“ Physik (oder auch „vollständiger“ Psychologie usw.). Man könnte höchstens vertreten, dass es bestenfalls eine wahre und vollständige Beschreibung gibt, die unsere Begriffe gebraucht. Das muss aber wegen der Vagheit unserer gegenwärtigen Begriffe mir Vorsicht behandelt werden. Theorie/Welt/FieldVsPutnam: der mR sollte sich von seinem Gegner, dem iR nicht durch Annahme einer einzig wahren Theorie unterscheiden. 3. mR3/Field: These Wahrheit involviert eine Art Korrespondenztheorie zwischen Wörtern und äußeren Dingen. VsmR3/VsKorrespondenztheorie/Field: die Korrespondenztheorie wird von vielen Leuten abgelehnt, sogar von Vertretern des mR1 (geistunabhängige Objekte). Field IV 429 metaphysischer Realismus/mR/FieldVsPutnam: ein metaphysischer Realist ist einer der alle drei Thesen akzeptiert: mR1: die Welt besteht aus einer fixen Totalität geist unabhängiger Objekte. mR2: es gibt nur eine wahre und vollständige Beschreibung der Welt. mR3: Wahrheit involviert eine Form der Korrespondenztheorie. PutnamVsField: diese drei haben keinen klaren Inhalt, wenn sie getrennt werden. Was heißt „Objekt“ oder „fixe Totalität“ „aller Objekte“ „Geist Unabhängigkeit“ außerhalb bestimmter philosophischer Diskurse? Allerdings kann ich mR2 verstehen, wenn ich mR3 annehme. I: sei eine definite Menge von Individuen Field IV 430 P: Menge aller Eigenschaften und Relationen Ideale Sprache: Angenommen, wir haben eine ideale Sprache mit einem Namen für jedes Element von I und einem Prädikat für jedes Element von P. Diese Sprache wird nicht abzählbar sein (außer wir nehmen Eigenschaften als Extensionen) und dann auch nur abzählbar, wenn die Zahl der Individuen endlich ist. Aber sie ist eindeutig bis zum Isomorphismus (aber nicht weiter, unique up to isomorphism). Theorie der Welt/Putnam: die Menge der wahren Sätze in Bezug auf jeden bestimmten Typ (up to any definite type) wird ebenfalls eindeutig sein. Gesamtheit/Totalität/Putnam: umgekehrt: wenn wir annehmen, dass es eine ideale Theorie der Welt gibt, dann ist der Begriff einer „fixen Totalität“ (von Individuen und ihren Eigenschaften und Relationen) natürlich dadurch erklärt, dass die Totalität der Individuen mit dem Bereich der Individuenvariablen identifiziert wird, und die Totalität der Eigenschaften und Relationen mit dem Bereich der Prädikatvariablen innerhalb der Theorie. PutnamVsField: wenn er recht hätte und es keine objektive Rechtfertigung gibt, wie kann es dann eine Objektivität der Interpretation geben? Field/Putnam: könnte zwei Positionen beziehen: 1. er könnte sagen, dass es eine Tatsache gibt in Bezug darauf was eine gute „rationale Rekonstruktion“ der Sprecherintention ist . Und dass die Behandlung von „Elektron“ als starrer Designator (von „welcher Entität auch immer“, die für bestimmte Effekte verantwortlich ist und gewissen Gesetzen gehorcht, aber keine objektive Tatsache der Rechtfertigung. Oder. 2. er könnte sagen, dass Interpretation subjektiv ist, aber dass das nicht heißt, dass Referenz subjektiv ist. Ad 1.: hier müsste er behaupten, dass eine echte „rationale Rekonstruktion“ der Sprecher Intention von „allgemeinem Erkennen“ abgetrennt ist, und auch von „induktiver Kompetenz“ usw. Problem: wieso soll dann die Entscheidung, dass etwas („annäherungsweise“) bestimmten Gesetzen gehorcht oder nicht gehorcht, was dann für Bohrs Elektronen von 1900 und 1934 gilt, aber nicht für Phlogiston) der Natur nach völlig verschieden sein (und isolierbar sein) von Entscheidungen über Vernünftigkeit im allgemeinen? Ad 2.: das würde behaupten, dass wir einen Begriff von Referenz haben, der unabhängig von Prozeduren und Praktiken ist, mit dem wir entscheiden, ob verschiedene Leute in verschiedenen Situationen mit verschiedenen Hintergrundüberzeugungen tatsächlich auf die selben Dinge referieren. Das scheint unverständlich. Referenz/Theorie Wechsel/Putnam: wir nehmen selbstverständlich an, dass die Leute, die vor 200 Jahren über Pflanzen gesprochen haben, im großen und ganzen sich auf dasselbe bezogen wie wir. Wenn alles das subjektiv wäre, gäbe s überhaupt keinen intertheoretischen interlinguistischen Begriff von Referenz und Wahrheit. Wenn Referenz allerdings objektiv ist, dann möchte ich fragen, warum die Begriffe der Übersetzung und Interpretation in besserer Form sind als der Begriff der Rechtfertigung. III 208 Referenz/PutnamVsField: es gibt nichts, was im Wesen der Bezugnahme läge und dafür sorgte, dass die Verbindung zweier Ausdrücke durch "und" überhaupt irgend ein Ergebnis nach sich zieht! Kurz, wir benötigen eine Theorie der „Bezugnahme durch Beschreibung“. V 70 Referenz/FieldVsPutnam: neuerdings andere Ansicht: Bezug ist eine „physikalistische Beziehung“: komplexe kausale Beziehungen zwischen Wörtern oder geistigen Repräsentationen und Gegenständen. Es ist Aufgabe der empirischen Wissenschaft, herauszufinden, um welche physikalistische Beziehung es sich handelt. PutnamVsField: das ist nicht unproblematisch. Nehmen wir an, es gebe eine mögliche physikalistische Definition des Bezugs, nehmen wir außerdem an: (1) x bezieht sich auf y dann und nur dann, wenn x in R zu y steht. Wobei R eine Beziehung ist, die naturwissenschaftlich definiert ist, ohne semantische Begriffe (wie „bezieht sich auf“). Dann ist (1) ein Satz, der sogar unter Annahme der Theorie wahr ist, dass der Bezug nur durch operationale oder theoretische Vorbedingungen bestimmt ist. Satz (1) wäre demnach ein Bestandteil unserer „Reflexionsgleichgewicht“ Theorie (s.o.) der Welt, bzw. unserer »Idealgrenzen« Theorie der Welt. V 71 Bezug/Referenz/PutnamVsOperationalismus: wird der Bezug jedoch nur durch operationale und theoretische Vorbedingungen bestimmt, ist der Bezug von »x steht in R y« seinerseits unbestimmt! Die Kenntnis, dass (1) wahr ist, nutzt also nicht. Jedes zulässige Modell unserer Objektsprache wird einem Modell in unserer Metasprache korrespondieren, in dem (1) gilt, und die Interpretation von „x steht in R zu y“ wird die Interpretation von „x bezieht sich auf y“ festlegen. Dies wird jedoch nur eine Beziehung in jedem zulässigen Modell sein und gar nichts dazu beitragen, die Anzahl der zulässigen Modelle zu verringern! FieldVs: das ist freilich nicht, was Field beabsichtigt. Er behauptet (a) dass es eine bestimmte eindeutige Beziehung zwischen Wörtern und Dingen gibt, und (b) dass dies die Beziehung ist, die auch bei der Zuordnung eines Wahrheitwerts zu (1) als Bezugsrelation zu verwenden ist. PutnamVsField: das lässt sich jedoch nicht unbedingt dadurch ausdrücken, dass man (1) einfach ausspricht, und es ist ein Rätsel, wie wir das, was Field sagen möchte, ausdrücken lernen könnten. Field: eine bestimmte eindeutige Beziehung zwischen Wörtern und Gegenständen ist wahr. PutnamVsField: wenn es so ist, dass (1) in dieser Auffassung wahr ist wodurch wird es dann wahr gemacht? Wodurch wird eine bestimmte Entsprechung R ausgesondert? Es hat den Anschein, als müsse der Umstand, dass R tatsächlich der Bezug ist, ein metaphysisch unerklärbares Faktum sein. (Also magische Theorie der Bezugnahme, als ob Bezugnahme den Dingen intrinsisch anhaftete). (Nicht zu verwechseln mit Kripkes „metaphysisch notwendiger“ Wahrheit)! Putnam I (c) 93 PutnamVsField: Wahrheit und Referenz sind keine kausal erklärenden Begriffe! Jedenfalls in einem gewissen Sinn: selbst wenn Boyds kausale Erklärungen des Erfolgs der Wissenschaft falsch sind, brauchen wir sie z.B. immer noch, um formale Logik zu treiben. |
Putnam I Hilary Putnam Von einem Realistischen Standpunkt In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Frankfurt 1993 Putnam I (a) Hilary Putnam Explanation and Reference, In: Glenn Pearce & Patrick Maynard (eds.), Conceptual Change. D. Reidel. pp. 196--214 (1973) In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (b) Hilary Putnam Language and Reality, in: Mind, Language and Reality: Philosophical Papers, Volume 2. Cambridge University Press. pp. 272-90 (1995 In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (c) Hilary Putnam What is Realism? in: Proceedings of the Aristotelian Society 76 (1975):pp. 177 - 194. In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (d) Hilary Putnam Models and Reality, Journal of Symbolic Logic 45 (3), 1980:pp. 464-482. In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (e) Hilary Putnam Reference and Truth In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (f) Hilary Putnam How to Be an Internal Realist and a Transcendental Idealist (at the Same Time) in: R. Haller/W. Grassl (eds): Sprache, Logik und Philosophie, Akten des 4. Internationalen Wittgenstein-Symposiums, 1979 In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (g) Hilary Putnam Why there isn’t a ready-made world, Synthese 51 (2):205--228 (1982) In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (h) Hilary Putnam Pourqui les Philosophes? in: A: Jacob (ed.) L’Encyclopédie PHilosophieque Universelle, Paris 1986 In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (i) Hilary Putnam Realism with a Human Face, Cambridge/MA 1990 In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (k) Hilary Putnam "Irrealism and Deconstruction", 6. Giford Lecture, St. Andrews 1990, in: H. Putnam, Renewing Philosophy (The Gifford Lectures), Cambridge/MA 1992, pp. 108-133 In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam II Hilary Putnam Repräsentation und Realität Frankfurt 1999 Putnam III Hilary Putnam Für eine Erneuerung der Philosophie Stuttgart 1997 Putnam IV Hilary Putnam "Minds and Machines", in: Sidney Hook (ed.) Dimensions of Mind, New York 1960, pp. 138-164 In Künstliche Intelligenz, Walther Ch. Zimmerli/Stefan Wolf Stuttgart 1994 Putnam V Hilary Putnam Vernunft, Wahrheit und Geschichte Frankfurt 1990 Putnam VI Hilary Putnam "Realism and Reason", Proceedings of the American Philosophical Association (1976) pp. 483-98 In Truth and Meaning, Paul Horwich Aldershot 1994 Putnam VII Hilary Putnam "A Defense of Internal Realism" in: James Conant (ed.)Realism with a Human Face, Cambridge/MA 1990 pp. 30-43 In Theories of Truth, Paul Horwich Aldershot 1994 SocPut I Robert D. Putnam Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community New York 2000 Field I H. Field Realism, Mathematics and Modality Oxford New York 1989 Field II H. Field Truth and the Absence of Fact Oxford New York 2001 Field III H. Field Science without numbers Princeton New Jersey 1980 Field IV Hartry Field "Realism and Relativism", The Journal of Philosophy, 76 (1982), pp. 553-67 In Theories of Truth, Paul Horwich Aldershot 1994 |
| Kompetenz Sprache | Goodman Vs Fodor, J. | IV 141 GoodmanVsFodor: Zeitgenössische Theoretiker behaupten, daß Sprachkompetenz auf einem Lexikon und einer Grammatik im Bewußtsein beruhe. (Chomsky. GoodmanVs) das mentale Lexikon legt die Bedeutung der einzelnen Wörter fest. Die mentale Grammatik legt fest, in welcher Weise sich die Bedeutungen signifikanter Wortfolgen von den Bedeutungen ihrer Konstituenten herleiten. IV 143 Als ob das Bewußtsein ein digitaler Computer wäre. Der Reiz besteht in der verführerischen Ananlogie zu alltäglichen Maschinen und eben dem Computer. Laut Jerry Fodor ist der Computer das einzige Modell des Bwußtseins, über das wir verfügen. Aber Introspektion bringt uns hier auch nicht im entferntesten an eine Verifikation heran: die Befürworter der zu prüfenden Ansicht geben zu, daß der Zugriff auf den internen Code ein zutiefst unbewußter Vorgang ist. Der Grund für die überzeugung, daß er vorkommt ist, daß er in eine leistungfähige linguistische Theorie eingebettet ist. Wir sollen glauben, daß Sprecher auf einen internen syntaktischen und semantischen Code "Zugriff haben" und zwar aufgrund einer Analogie zur gegenseitigen Anziehungskraft von Körpern. Ich kann wissen, daß "Ulme" und "Buche" getrennte Klassen von Laubbäumen sind, aber keine Vorstellung haben, wie man sie unterscheidet. Goodman: meine SprachKompetenz wird durch mein Nichtwissen nicht gefährtdet. Ich kann mich anderen Mitgliedern der Sprachgemeinschaft anschließen, um meine Lücken zu füllen. Außerdem ist das fragliche Wissen nicht primär sprachlich, hier botanisch bzw. biographisch. Fodor gibt in diesem Punkt nach, und zieht den Schluß, daß das Lexikon referentiell undurchlässig ist. Seine Eintragungen legen die Begriffe fest, in denen wir denken, aber nicht das, worüber wir denken. IV 144 Die Analogie zum Computermodell ist ambig, weil sie eine referentielle und eine computermäßige Interpretation besitzt. I 145 Der Computer weiß natürlich nichts von der referentiellen Interpretation. - Dementsprechend würden wir nicht wissen, daß eine Computersimulation eine molekulare Interaktion repräsentiert - Aber nach Fodor ist genau dies unsere Situation im Hinblick auf Sätze die wir verstehen. - Fragen nach dem Wahrheitswert von Sätzen sind nach der computermäßigen Lesart unangebracht. Fodors Theorie kann weder erklären, wie wir wissen, was neue Sätze rep, noch, was vertraute rep. Die Rolle des Lexikons hat sich herausgebildet, um anderen Zwecken zu dienen. Die Linguisten können Verstehen metaphorischer Sprache nicht erklären. |
G IV N. Goodman Catherine Z. Elgin Revisionen Frankfurt 1989 Goodman I N. Goodman Weisen der Welterzeugung Frankfurt 1984 Goodman II N. Goodman Tatsache Fiktion Voraussage Frankfurt 1988 Goodman III N. Goodman Sprachen der Kunst Frankfurt 1997 |
| Kompetenz Sprache | Dummett Vs Holismus | Fodor/Lepore IV 8 analytisch/synthetisch(a/s)/Holismus/Fodor/Lepore: es gibt ein Argument dafür, dass anatomische Eigenschaften auch holistisch sind, das voraussetzt, dass die Unterscheidung anal/synth. (a/s) aufgehoben ist. Bsp DummettVsHolismus: zeigt weder, wie Kommunikation funktionieren soll, noch Spracherwerb oder Sprachbeherrschung. (Wenn man zugleich allle Propositionen kennen muss, was unmöglich ist). ((s) Das setzt also voraus, dass auch anatomische Eigenschaften holistisch sind. (bzw. dass es keine anatomischen Eig gibt). Durch diese Extremposition wird Lernen erst unmöglich). Dummett/(s)VsDummett: geht also von der extremen Annahme aus, dass anatomische Eigenschaften (die nur ein zweites gleichartiges Ding annehmen) zugleich holistisch sind, d.h. viele gleichgeartete Dinge annehmen. Also quasi ein Popanz. Dummett: genausowenig zeigt der Holismus, wie eine gesamte Theorie überhaupt signifikant sein kann: wenn ihre interne Struktur nicht ihrerseits in signifikante Teile zerlegt werden kann, dann hat sie keine interne Struktur. Fodor/Lepore: Dummett argumentiert aus folgender Analogie: Sätze sind interpersonell verstehbar, weil ihre Bedeutungen aus den Bedeutungen ihrer Komponenten gebildet werden und Sprecher und Hörer sind in diese Bedeutungen eingeweiht. Dummett/Fodor/Lepore: diese Erklärung setzt voraus, dass Sprecher und Hörer dasselbe meinen. IV 9 Und es setzt voraus, dass die Konstituenten überhaupt Bedeutung haben. Wenn der Holismus wahr wäre, wäre das falsch. IV 10 Holismus/Fodor/Lepore: ist auch ein Revisionismus: er könnte HolismusVsDummett: antworten: "um so schlimmer für unser konventionelles Verstehen davon, wie Sprachen und Theorien gelernt und vermittelt werden". Quine, Dennett, Stich, die Churchlands und viele andere sind stark versucht von dieser revisionistischen Richtung. Horwich I 459 Bedeutungstheorie/m.th./DummettVsDavidson: wir brauchen mehr, als er uns gibt: es könnte sein, dass jemand alle WB kennt ohne den Inhalt der (metasprachlichen) rechten Seite des T Satzes zu kennen. T-sentence/Dummett: erklärt gar nichts, wenn die MetaSprache ((MS) die ObjektSprache (OS) enthält. Und weil das so ist, gilt das gleiche auch, wenn MS und OS getrennt sind. (Terminologie/Dummett: „M Satz“ (M- sentence“. T-sentence/Davidson: Z „neutrale, schneegebundene Trivialität“. Kein einzelner T Satz sagt, was es heißt, die Wörter auf der linken Seite zu verstehen, aber das ganze Korpus von Sätzen sagt dass dies alles ist, was man darüber wissen kann. ((s) keine Theorie „jenseits“, „darüber“). DummettVsDavidson: damit gesteht Davidson eine Niederlage ein: dann kann man nicht beantworten, wie der Sprecher zu seinem eigenen Verständnis der von ihm gebrauchten Wörter kommt. ((s) > DummettVsHolism). DummettVsDavidson: man kann dann seine Fähigkeit zum Sprachgebrauch nicht in einzelne Teilfähigkeiten aufteilen. Sprache/Gebrauch/Wittgenstein/Davidson/SellarsVsDummett/Rorty: solche Teilfähigkeiten gibt es gar nicht. Wenn „tertia“ wie „bestimmte Bedeutung“, „Reaktion auf Reize“ usw. abgeschafft sind, gibt es keine Komponenten mehr, in die man die Fähigkeit zum Sprachgebrauch (>Kompetenz?) aufteilen könnte. Bsp „Woher weißt du, dass das rot ist?“ Wittgenstein: „ich spreche deutsch“. T-sentence/Davidson: verdoppelt nicht irgendwelche inneren Strukturen. Die gibt es auch gar nicht, sonst würde man die „tertia“ wieder einführen. BT/DummettVsDavidson/Rorty: dieser macht aus der Not eine Tugend. Wir können aber von einer BT mehr erwarten. Und zwar wird sie die traditionellen Begriffe der empiristischen Erkenntnistheorie bewahren. Eine solche Theorie muss die Fähigkeit zum Sprachgebrauch durch Kenntnis der WB erklären . Dummett: Kontrast: Bsp „das ist rot“ und Bsp „es gibt transfinite Kardinalzahlen“. Holismus/Wittgenstein/VsDummett/DavidsonVsDummett: hier gibt es gar keinen Kontrast! Verstehen/Erfassen/Wittgenstein/Davidson/Rorty: für Davidson und Wittgenstein ist das Erfassen in all diesen Fällen ein Erfassen der inferentiellen Relationen zwischen den Sätzen und anderen Sätzen der Sprache. Bedeutung/Wittgenstein: das Akzeptieren irgendeines Schlussprinzips (inferential principle) trägt dazu bei, die Bedeutung der Wörter zu bestimmen. (Davidson dito). DummettVsWittgenstein/DummettVsHolism: das führt uns zu der Einstellung, dass keine systematische BT überhaupt möglich ist. RortyVsDummett: erzeigt aber nicht, wie sie möglich ist.(1) 1. Richard Rorty (1986), "Pragmatism, Davidson and Truth" in E. Lepore (Ed.) Truth and Interpretation. Perspectives on the philosophy of Donald Davidson, Oxford, pp. 333-55. Reprinted in: Paul Horwich (Ed.) Theories of truth, Dartmouth, England USA 1994 Rorty I 289 Philosophie/Dummett/Rorty: (VsDavidson) (wie Putnam): einzige Aufgabe der Philosophie ist die Analyse von Bedeutung. (Sie ist das Fundament, und nicht Descartes Erkenntnistheorie). DummettVsDavidson/DummettVsHolismus/Rorty: man kann keine angemessene Sprachphilosophie ohne die beiden Kantischen Unterscheidungen (Gegebenheit/Interpretation und Notwendigkeit/Kontingenz) schreiben. |
Dummett I M. Dummett Ursprünge der analytischen Philosophie Frankfurt 1992 Dummett II Michael Dummett "What ist a Theory of Meaning?" (ii) In Truth and Meaning, G. Evans/J. McDowell Oxford 1976 Dummett III M. Dummett Wahrheit Stuttgart 1982 Dummett III (a) Michael Dummett "Truth" in: Proceedings of the Aristotelian Society 59 (1959) pp.141-162 In Wahrheit, Michael Dummett Stuttgart 1982 Dummett III (b) Michael Dummett "Frege’s Distiction between Sense and Reference", in: M. Dummett, Truth and Other Enigmas, London 1978, pp. 116-144 In Wahrheit, Stuttgart 1982 Dummett III (c) Michael Dummett "What is a Theory of Meaning?" in: S. Guttenplan (ed.) Mind and Language, Oxford 1975, pp. 97-138 In Wahrheit, Michael Dummett Stuttgart 1982 Dummett III (d) Michael Dummett "Bringing About the Past" in: Philosophical Review 73 (1964) pp.338-359 In Wahrheit, Michael Dummett Stuttgart 1982 Dummett III (e) Michael Dummett "Can Analytical Philosophy be Systematic, and Ought it to be?" in: Hegel-Studien, Beiheft 17 (1977) S. 305-326 In Wahrheit, Michael Dummett Stuttgart 1982 Horwich I P. Horwich (Ed.) Theories of Truth Aldershot 1994 Rorty I Richard Rorty Der Spiegel der Natur Frankfurt 1997 Rorty II Richard Rorty Philosophie & die Zukunft Frankfurt 2000 Rorty II (b) Richard Rorty "Habermas, Derrida and the Functions of Philosophy", in: R. Rorty, Truth and Progress. Philosophical Papers III, Cambridge/MA 1998 In Philosophie & die Zukunft, Frankfurt/M. 2000 Rorty II (c) Richard Rorty Analytic and Conversational Philosophy Conference fee "Philosophy and the other hgumanities", Stanford Humanities Center 1998 In Philosophie & die Zukunft, Frankfurt/M. 2000 Rorty II (d) Richard Rorty Justice as a Larger Loyalty, in: Ronald Bontekoe/Marietta Stepanians (eds.) Justice and Democracy. Cross-cultural Perspectives, University of Hawaii 1997 In Philosophie & die Zukunft, Frankfurt/M. 2000 Rorty II (e) Richard Rorty Spinoza, Pragmatismus und die Liebe zur Weisheit, Revised Spinoza Lecture April 1997, University of Amsterdam In Philosophie & die Zukunft, Frankfurt/M. 2000 Rorty II (f) Richard Rorty "Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache", keynote lecture for Gadamer’ s 100th birthday, University of Heidelberg In Philosophie & die Zukunft, Frankfurt/M. 2000 Rorty II (g) Richard Rorty "Wild Orchids and Trotzky", in: Wild Orchids and Trotzky: Messages form American Universities ed. Mark Edmundson, New York 1993 In Philosophie & die Zukunft, Frankfurt/M. 2000 Rorty III Richard Rorty Kontingenz, Ironie und Solidarität Frankfurt 1992 Rorty IV (a) Richard Rorty "is Philosophy a Natural Kind?", in: R. Rorty, Objectivity, Relativism, and Truth. Philosophical Papers Vol. I, Cambridge/Ma 1991, pp. 46-62 In Eine Kultur ohne Zentrum, Stuttgart 1993 Rorty IV (b) Richard Rorty "Non-Reductive Physicalism" in: R. Rorty, Objectivity, Relativism, and Truth. Philosophical Papers Vol. I, Cambridge/Ma 1991, pp. 113-125 In Eine Kultur ohne Zentrum, Stuttgart 1993 Rorty IV (c) Richard Rorty "Heidegger, Kundera and Dickens" in: R. Rorty, Essays on Heidegger and Others. Philosophical Papers Vol. 2, Cambridge/MA 1991, pp. 66-82 In Eine Kultur ohne Zentrum, Stuttgart 1993 Rorty IV (d) Richard Rorty "Deconstruction and Circumvention" in: R. Rorty, Essays on Heidegger and Others. Philosophical Papers Vol. 2, Cambridge/MA 1991, pp. 85-106 In Eine Kultur ohne Zentrum, Stuttgart 1993 Rorty V (a) R. Rorty "Solidarity of Objectivity", Howison Lecture, University of California, Berkeley, January 1983 In Solidarität oder Objektivität?, Stuttgart 1998 Rorty V (b) Richard Rorty "Freud and Moral Reflection", Edith Weigert Lecture, Forum on Psychiatry and the Humanities, Washington School of Psychiatry, Oct. 19th 1984 In Solidarität oder Objektivität?, Stuttgart 1988 Rorty V (c) Richard Rorty The Priority of Democracy to Philosophy, in: John P. Reeder & Gene Outka (eds.), Prospects for a Common Morality. Princeton University Press. pp. 254-278 (1992) In Solidarität oder Objektivität?, Stuttgart 1988 Rorty VI Richard Rorty Wahrheit und Fortschritt Frankfurt 2000 |
| Kompetenz Sprache | Horwich Vs Kripke, Saul A. | Stegmüller IV 154 Meinen/Kripkes Wittgenstein/HorwichVsWittgenstein/HorwichVsKripke: Die Liste (s.o.) muss ergänzt werden: d) Mit "plus" die Addition zu meinen, schließt nicht aus, dass Fehler gemacht werden. Das darf von keinem Bedeutungsbegriff verletzt werden. e) Die Bedeutung von "plus" ist eine intrinsische Eigenschaft! Das steht aber im Widerspruch zu d)! Horwich: Gehirnuntersuchungen könnten übrigens Übereinstimmungen hervorbringen. Kripke und Wittgenstein haben zwar gezeigt, dass es keine Tatsachen des Meinens geben müsse, aber nicht, dass es keine geben könnte! IV 154/155 Stegmüller: Auch Wittgenstein würde eine Rückkehr zur Empirie sicher begrüßen, aber eine Theorie könnte die Übereinstimmung wohl als Tatsache feststellen (wie die Theorie von Chomsky) aber immer noch nur im Rahmen von Behauptbarkeitsbedingungen (Rechtfertigungsbedingungen), nicht im Sinne einer wahrheitsfunktionalen Semantik. Turingmaschine/Kripkes Wittgenstein/Stegmüller/Chomsky: Bsp (Kripke) Eine vom Himmel gefallene Maschine lässt sich in Bezug auf alles Relevante analysieren (Programm und Gedächtnis). a) Stegmüller: Damit akzeptiert Chomsky eine Auffassung, die eine geradlinige Lösung des Paradoxons enthält. Wir erkennen aufgrund von Unterschieden im Programm, ob "plus" oder "quus" repräsentiert ist. Denn wir verfügen über eine Theorie, die uns etwas über Unterschiede sagt. IV 156 b) Geradlinige Lösung: sprachliche Kompetenz. Wir unterscheiden wohlgeformte von nichtwohlgeformten Lautbildungen. IV 157 "Schaltermodell"/internalisierte Sprache: Im strukturellen Urzustand mag es viele Schalter geben, die auf "Null" gestellt sind, und darauf warten, in aktive Positionen gebracht zu werden. Sprache ist nichts anderes als eine vorliegende stabile Schaltereinstellung (internalisierte Sprache). |
Horwich I P. Horwich (Ed.) Theories of Truth Aldershot 1994 |
| Kompetenz Sprache | Cresswell Vs Lewis, David | I 23 Performanz/Kompetenz/semantische/Cresswell: welche Beziehungen gibt es zwischen beiden? Lewis: Konvention der Wahrhaftigkeit und des Vertauens: in L: These: darauf basiert der meiste Sprachgebrauch. I 24 Wir nehmen an, die Sprecher versuchen, wahre Sätze zu äußern und erwarten dasselbe von den anderen. Pointe/CresswellVsLewis: das kann nun so sein, scheint mir aber eher eine Frage der empirische Untersuchung als eine Definition, daß es so sein sollte, zu sein. Und zwar deshalb: I 33 Sprache /Bigelow/Cresswell: John Bigelow erzählt mir, These: daß eine der frühesten Funktionen der Sprache Geschichtenerzählen war. Dann geht es mehr um Vorstellungskraft als um alltägliche Kommunikation! ((s)VsCresswell: 1. woher weiß Bigelow das? 2. warum sollte man daraus so weitgehende Schlüsse ziehen?). CresswellVsLewis: selbst wenn sich herausstellen sollte, daß es eine logische Verbindung zwischen der Konvention und dem Sprachgebrauch gäbe, scheint es mir besser, das nicht von vornherein in eine Theorie der Semantik einzubauen. Jedenfalls brauchen wir keine Verbindung von Kompetenz und Performanz. II 142 Fiktion/Glauben de re/Lewis/Cresswell: (Lewis 1981, 288): Bsp in Frankreich glauben die Kinder, daß Papa Noel allen Kindern Geschenke bringt, in England Father Christmas nur den braven (, diese kommen dafür das doppelte, wie Pierre sich ausrechnet). de re/Fiktion/Lewis: das kann keine Einstellung de re sein, weil es diese res in beiden Fällen nicht gibt. Fiktion/CresswellVsLewis: auch hier kann man eine Referenz de re haben, auch wenn die Kausalverbindung nicht direkt ist. Lösung/Devitt: das Geschichtenerzählen. |
Cr I M. J. Cresswell Semantical Essays (Possible worlds and their rivals) Dordrecht Boston 1988 Cr II M. J. Cresswell Structured Meanings Cambridge Mass. 1984 |
| Kompetenz Sprache | Lewis Vs Markeresisch | IV 189/190 Semantisch Markeresisch/semantische Marker/LewisVsKatz: (nach: Katz, Jerrold & Paul Postal: An Integrated Theory of Linguistic Descriptions, Cambridge, Mass. MIT:1964). Semantische Marker sind Symbole oder Gegenstände in einer künstlichen Sprache, die wir "semantisch Markeresisch" nennen können. Die semantische Interpretation durch dieses Mittel führt bloß zu einem Übersetzungsalgorithmus aus der ObjektSprache in die HilfsSprache Markeresisch! Aber dann können wir die markeresische Übersetzung auch kennen, ohne irgend etwas über die Bedeutung des ursprünglichen englischen Satzes zu wissen! Nämlich ohne die Bedingungen zu kennen, unter denen er wahr wäre. Semantik ohne Wahrheitsbedingungen ist keine Semantik! Die Übersetzung ins Markeresische hängt entweder von unserer (zukünftigen) Kompetenz als Sprecher des Markeresischen ab oder von unserer Fähigkeit, Semantik wenigstens auf Markeresisch anzuwenden. Dann würde aber eine Übersetzung ins Lateinische genauso genügen, wenn die Semantik für Markeresisch vielleicht auch etwas einfacher wäre. Markeresisch/Lewis: pro: Markeresisch ist attraktiv, weil es nur mit Symbolen umgeht. Endliche Kombinationen vertrauter Entitäten bilden eine endliche Menge von Elementen mit endlichen Anwendungen endlicher Regeln. Dies ist kein Problem für die ontologische Sparsamkeit. VsMarkeresisch: Aber es ist gerade diese angenehme Endlichkeit die die Semantik des Markeresischen daran hindert, Relationen zwischen den Symbolen und der wirklichen Welt der Nicht-Symbole zu knüpfen! Also ist es keine echte Semantik. |
Lewis I David K. Lewis Die Identität von Körper und Geist Frankfurt 1989 Lewis I (a) David K. Lewis An Argument for the Identity Theory, in: Journal of Philosophy 63 (1966) In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis I (b) David K. Lewis Psychophysical and Theoretical Identifications, in: Australasian Journal of Philosophy 50 (1972) In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis I (c) David K. Lewis Mad Pain and Martian Pain, Readings in Philosophy of Psychology, Vol. 1, Ned Block (ed.) Harvard University Press, 1980 In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis II David K. Lewis "Languages and Language", in: K. Gunderson (Ed.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol. VII, Language, Mind, and Knowledge, Minneapolis 1975, pp. 3-35 In Handlung, Kommunikation, Bedeutung, Georg Meggle Frankfurt/M. 1979 Lewis IV David K. Lewis Philosophical Papers Bd I New York Oxford 1983 Lewis V David K. Lewis Philosophical Papers Bd II New York Oxford 1986 Lewis VI David K. Lewis Konventionen Berlin 1975 LewisCl Clarence Irving Lewis Collected Papers of Clarence Irving Lewis Stanford 1970 LewisCl I Clarence Irving Lewis Mind and the World Order: Outline of a Theory of Knowledge (Dover Books on Western Philosophy) 1991 |
| Kompetenz Sprache | Chomsky Vs Quine, W.V.O. | II 319 Sprache/Quine: Geflecht von Sätzen. Theorie/Sprache/ChomskyVsQuine: Quine selbst muß sogar voraussetzen, daß beide getrennt sind: er ist sicher nicht der Ansicht, daß zwei monolinguale Sprecher der selben Sprache keine Meinungsverschiedenheiten haben können! ((s) Wenn Sprache und Theorie identisch wären, könnte man sich nicht streiten, da selbst nach Quine die Theorien eine gewisse Einheitlichkeit haben müssen). Chomsky: sonst wäre nach Quine jeder Streit völlig irrational, wie zwischen zwei Sprechern verschiedener Sprachen. II 320 Def Sprache/Quine: "Komplex von vorliegenden Dispositionen zu verbalem Verhalten, in denen sich Sprecher derselben Sprache notgedrungen einander angeglichen haben". (W+O,27) Sprache/ChomskyVsQuine: dann müßte sich unsere Disposition zu einem bestimmten Verbalverhalten durch ein bestimmtes System erklären lassen. Das ist sicher nicht der Fall. II 321 Verstärkung/ChomskyVsQuine: sein Begriff der "Verstärkung" ist nahezu leer. Wenn zum Lernen Verstärkung benötigt wird, läuft das darauf hinaus, daß Lernen nicht ohne Daten vonstatten gehen kann. Das ist noch leerer als bei Skinner, der im Gegensatz zu Quine nicht einmal verlangt, daß verstärkende Reize einwirken. Hier genügt es, daß die Verstärkung bloß vorgestellt ist. II 324 Sprachlernen: behavioristisch/Quine: Konditionierung, Assoziation ChomskyVsQuine: zusätzlich Prinzipien, nur so unendlich viele Sätze erklärbar. Wahrscheinlichkeit/Sprache/ChomskyVsQuine: der Begriff der "Wahrscheinlichkeit eines Satzes" ist völlig nutzlos und leer: II 325 Übersetzungsunbestimmtheit, Unbestimmtheit: ChomskyVsQuine: Disposition entweder in Bezug auf Reiz, oder in Bezug auf Gesamtkorpus der Sprache: dann alle Sätze gleichwahrscheinlich (Bezugsklassen) II 326 logische Wahrheit/Quine: wird bei ihm von Konditionierungsmechanismen hergeleitet, die bestimmte Satzpaare miteinander assoziieren, II 327 so daß unsere Kenntnis der logischen Relationen als ein finites System verknüpfter Sätze repräsentierbar sein muß. ChomskyVsQuine: dabei bleibt unklar, wie wir logische von kausalen Relationen unterscheiden. Wahrheitsfunktionen/Quine: erlauben eine radikale Übersetzung ohne "nicht verifizierbare analytische Hypothesen" daher lassen sie sich aus dem empirischen Datenmaterial unmittelbar erlernen (W+O § 13) ChomskyVsQuine: seine Bereitschaft, diese Dinge innerhalb des Rahmens der radikalen Übersetzung anzusiedeln, zeigt möglicherweise, daß er bereit ist, Logik als eine angeborene erfahrungsunabhängige Basis für das Lernen anzusehen. Dann ist es jedoch willkürlich, gerade diesen Rahmen als angeboren zu akzeptieren, und nicht auch vieles andere, das man ebenfalls beschreiben oder sich vorstellen kann. II 328 ChomskyVsQuine: sein eng gefaßter Humescher Rahmen (Chomsky pro) mit der Sprache als endlichem (!?) Geflecht von Sätzen ist mit diversen Binsenwahrheiten unverträglich, die auch Quine sicherlich akzeptieren würde II 329 analytische Hypothese/Reizbedeutung/Quine: Reizbedeutung involviert im Gegensatz zur analytischen Hypothese lediglich "normale induktive Ungewissheit". Da die entsprechenden Sätze Wahrheitsfunktionen enthalten können, führen sie zur "normalen Induktion". Das ist noch keine "Theoriekonstruktion" wie bei den analytischen Hypothesen. ChomskyVsQuine: die Unterscheidung ist nicht klar, weil die normale Induktion auch innerhalb der radikalen Übersetzung vorkommt. II 330 ChomskyVsQuine: Vs "Eigenschaftsraum": nicht sicher ob die Begriffe der Sprache mit physikalischen Dimensionen erklärt werden können Aristoteles: eher mit Handlungen verknüpft. - VsQuine: nicht evident, daß Ähnlichkeiten in einem Raum lokalisierbar sind Prinzipien, nicht "gelernte Sätze" I 333 VsQuine: kann nicht von "Disposition zur Reaktion" abhängig sein, sonst wären Stimmungen, Augenverletzungen, Ernährungsstand usw. zu maßgeblich I 343 Sprache muß vielleicht gar nicht gelehrt werden. II 335 Synonymie/ChomskyVsQuine: (dieser hatte vorgeschlagen, daß Synonymie "grob gesprochen" in annähernder Gleichheit der Situationen, und annähernd gleicher Wirkung bestehe). Chomsky: es besteht nicht einmal annähernde Gleichheit in den Bedingungen, die mit Wahrscheinlichkeit synonyme Äußerungen hervorbringen. ChomskyVsQuine: Synonymie kann man also nicht mit Hilfe von Gebrauchsbedingungen (Behauptungsbedingungen) oder Wirkungen auf den Hörer charakterisieren. Es ist wesentlich, zwischen langue und parole, zwischen Kompetenz und Performanz zu unterscheiden. Es geht um sinnvolle Idealisierung, Quines Idealisierung ist sinnlos. II 337 Übersetzungsunbestimmtheit/ChomskyVsQuine: die These läuft in einem psychologischen Kontext auf eine unplausible und ziemlich gehaltlose empirische Behauptung hinaus, nämlich darüber, welche angeborenen Eigenschaften der Geist zu Spracherwerb beisteuert. In einem erkenntnistheoretischen Kontext ist Quines These lediglich eine Version der bekannten skeptischen Argumente, die genauso gut auf die Physik oder anderes angewendet werden können. II 337 Unterbestimmtheit/Unbestimmtheit/Theorie/ChomskyVsQuine: jede Hypothese geht über die Daten hinaus, sonst wäre sie uninteressant Quine V 32 Def Sprache/Quine: „Komplex von Dispositionen zu sprachlichem Verhalten“. ((s) das könnte man zirkulär nennen, weil „sprachlich“ vorkommt. Vs: dann soll damit ausgedrückt werden, dass es neben dem Verhalten eben nicht noch eine Sprache gibt.) Disposition/ChomskyVsQuine: so ein Komplex lässt sich vermutlich als eine Menge von Wahrscheinlichkeiten darstellen, unter bestimmten Umständen eine Äußerung zu machen. Vs: der Begriff der Wahrscheinlichkeit bringt gar nichts: die Wahrscheinlichkeit, mit der ich einen bestimmten englischen Satz äußere, ist gar nicht zu unterscheiden von der Wahrscheinlichkeit, mit der ich einen bestimmten japanischen Satz äußere. QuineVsChomsky: man vergesse nicht, dass Dispositionen ihre Bedingungen haben. V 33 Diese finden wir durch das Verfahren von Frage und Zustimmung. Quine XI 115 Sprache/Theorie/ChomskyVsQuine/Lauener: die Sprache einer Person und ihre Theorie sind auf jeden Fall verschiedene Systeme, auch wenn man Quine sonst zustimmen würde. XI 116 Quine: (dito). Unbestimmtheit der Übersetzung: wegen ihr kann man nicht von einer gegenüber Übersetzungen invarianten Theorie sprechen. Man kann auch nicht sagen, dass eine absolute Theorie in verschiedenen Sprachen formulierbar sei, oder auch umgekehrt, dass verschiedene (sogar einander widersprechende) Theorien in einer Sprache ausgedrückt werden können. ((s) >Wegen der ontologischen Feststellung, dass ich nicht über Ontologie streiten kann, indem ich dem anderen sagen, dass es die Dinge, die es bei ihm gebe, bei mir nicht gibt, weil ich dann den Selbstwiderspruch aufstelle, dass es Dinge gibt, die es nicht gibt). Lauener: das entspräche dem Irrtum, dass die Sprache die Syntax, die Theorie aber den empirischen Gehalt beisteuere. Sprache/Theorie/Quine/Lauener: d.h. nicht, dass es gar keinen Gegensatz zwischen beiden gäbe: insofern dennoch zwei verschiedene Theorien in derselben Sprache niederlegt werden, heißt das dann, dass die Ausdrücke nicht in allen Ausdrücken austauschbar sind. Es gibt aber auch Kontexte, wo die Unterscheidung Sprache/Theorie keinen Sinn hat. Daher ist der Unterschied graduell. Die Kontexte, wo Sprache/Theorie austauschbar sind, sind die, wo Quine von einem Netzwerk spricht. |
Chomsky I Noam Chomsky "Linguistics and Philosophy", in: Language and Philosophy, (Ed) Sidney Hook New York 1969 pp. 51-94 In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Chomsky II Noam Chomsky "Some empirical assumptions in modern philosophy of language" in: Philosophy, Science, and Method, Essays in Honor of E. Nagel (Eds. S. Morgenbesser, P. Suppes and M- White) New York 1969, pp. 260-285 In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Chomsky IV N. Chomsky Aspekte der Syntaxtheorie Frankfurt 1978 Chomsky V N. Chomsky Language and Mind Cambridge 2006 Quine I W.V.O. Quine Wort und Gegenstand Stuttgart 1980 Quine II W.V.O. Quine Theorien und Dinge Frankfurt 1985 Quine III W.V.O. Quine Grundzüge der Logik Frankfurt 1978 Quine V W.V.O. Quine Die Wurzeln der Referenz Frankfurt 1989 Quine VI W.V.O. Quine Unterwegs zur Wahrheit Paderborn 1995 Quine VII W.V.O. Quine From a logical point of view Cambridge, Mass. 1953 Quine VII (a) W. V. A. Quine On what there is In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (b) W. V. A. Quine Two dogmas of empiricism In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (c) W. V. A. Quine The problem of meaning in linguistics In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (d) W. V. A. Quine Identity, ostension and hypostasis In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (e) W. V. A. Quine New foundations for mathematical logic In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (f) W. V. A. Quine Logic and the reification of universals In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (g) W. V. A. Quine Notes on the theory of reference In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (h) W. V. A. Quine Reference and modality In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (i) W. V. A. Quine Meaning and existential inference In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VIII W.V.O. Quine Bezeichnung und Referenz In Zur Philosophie der idealen Sprache, J. Sinnreich (Hg) München 1982 Quine IX W.V.O. Quine Mengenlehre und ihre Logik Wiesbaden 1967 Quine X W.V.O. Quine Philosophie der Logik Bamberg 2005 Quine XII W.V.O. Quine Ontologische Relativität Frankfurt 2003 Quine XIII Willard Van Orman Quine Quiddities Cambridge/London 1987 |
| Kompetenz Sprache | Danto Vs Searle, J.R. | I 273 Searle: bestreitet, dass hinsichtlich der linguistischen Kompetenz keine Unterscheidung möglich seien sollte. Chinese room: der Insassse beherrscht nicht die Sprache, verfährt aber nach festgelegten Regeln. Der Output ist nicht von Sprachkompetenz zu unterscheiden. DantoVsSearle: aber vielleicht macht das Gehirn der auch nicht mehr, als auf irgendeinen elektrischen Impuls mit elektrischen Reaktionen zu antworten. |
Danto I A. C. Danto Wege zur Welt München 1999 Danto III Arthur C. Danto Nietzsche als Philosoph München 1998 Danto VII A. C. Danto The Philosophical Disenfranchisement of Art (Columbia Classics in Philosophy) New York 2005 |
| Kompetenz Sprache | Schiffer Vs Soames, S. | I 217 kompositionale Semantik/kS/Verstehen/Erklärung/Scott Soames/Schiffer: (Soames 1987) These: kS wird nicht für das erklären des Spracheverstehens gebraucht, dennoch haben natürliche Sprachen eine kS: Sprachbeherrschung/Soames: man sollte nicht auf die Semantik schauen, um semantische Kompetenz zu erklären. Statt dessen braucht man kS für die Erklärung des repräsentationalen Charakters der Sprache. Die zentrale semantische Tatsache über Sprache ist, dass sie gebraucht wird, um die Welt zu repräsentieren. Sätze kodieren systematisch Information, die die Welt so und so charakterisieren. Wir brauchen sK für die Analyse der Prinzipien dieser Kodierung. SchifferVsSoames: statt dessen habe ich das Ausdrucks-Potential eingeführt. Man könnte annehmen, dass eine endlich formulierbare Theorie Theoreme für die Zuschreibung von AP zu jedem Satz der Sprache formulieren können sollte. Aber wäre das nicht dann eine kompositionale Theorie? I 218 Bsp Harvey: hier brauchten wir keine kS um anzunehmen, dass für jeden Satz von M (innere Sprache) es eine Realisation eines Glaubens gibt, d.h. (µ)(∑P)(wenn µ ein Satz von M ist und in der Box, dann glaubt Harvey, dass P) (s) Hier wird gar keine Verbindung zwischen µ und P spezifiziert). Schiffer: nun könnten wir eine Abbildung von Formeln von M ins Deutsche entdecken, also eine Übersetzung. Aber das liefert keine endliche Theorie, die für jede Formel µ von M ein Theorem liefern würde wie Wenn µ in der Box ist, dann glaubt Harvey dass Schnee manchmal purpurn ist. Propositionale Einstellung/BT/Schiffer: Problem: es ist nicht möglich, eine endliche Theorie zu finden, die Verben für Glauben Eigenschaften dieser Art zuschreibt. Pointe: dennoch haben die Ausdrücke in M Bedeutung! Bsp "Nemrac seveileb taht emos wons si elprup" würde den entsprechenden Glauben in Harvey realisieren und damit auch trivialerweise bedeuten. SchifferVsKompositionalität: wenn die Wort-Bedeutung einen Beitrag zur Satz-Bedeutung leistet, dann ist es dies. Und dann haben Ausdrücke in M auch Bedeutung. Aber das sind keine Eigenschaften, die in einer endlichen Theorie zugeschrieben werden können. Wir könnten nur die Eigenschaft feststellen, jedem Satz von M einen bestimmten Glauben zuzuschreiben, aber das kann nicht in einer endlichen Theorie geschehen. mentale Repräsentation/Mentalesisch/Schiffer: die Formeln in M sind mentale Repräsentationen. Sie repräsentieren äußere Zustände. Sätze von E, Harveys gesprochener Sprache erhalten ihren repräsentationalen Charakter über die Verbindung mit mentalen Repräsentationen. Daher braucht Mentalesisch keine kS. SchifferVsSoames: also hat er unrecht und wir brauchen die kS auch nicht für eine Darstellung dessen, wie unsere Sätze die Welt repräsentieren. I 219 Dieses Ergebnis hatten wir schon über die Ausdrucks-Potentiale erreicht. Denn: repräsentationaler Charakter: ist vom Ausdrucks-Potential nicht zu unterscheiden. |
Schi I St. Schiffer Remnants of Meaning Cambridge 1987 |
| Kompetenz Sprache | Searle Vs Tradition | II 28 Überzeugung/SearleVsTradition: sie ist eben nicht eine Art Bild! Sie ist einfach eine Repräsentation, d.h. sie hat einen propositionalen Gehalt, der die Erfüllungsbedingungen festlegt und einen psychischen Modus, der die Ausrichtung festlegt. II 49 SearleVsTradition: Überzeugungen und Wünsche sind nicht die grundlegenden intentionalen Zustände. Man kann sich seines Wunsches oder seiner Überzeugungen auch schämen. II 160 Tradition: man hat niemals ein Verursachungserlebnis. SearleVsTradition: man hat nicht nur häufig ein Verursachungserlebnis, sondern jedes Wahrnehmungs oder Handlungserlebnis ist in der Tat genau ein solches Verursachungserlebnis! SearleVsHume: er hat eine falsche Stelle gesucht, er suchte eine Kraft. II 190 Bsp Skifahren: traditionelle Auffassung: zunächst: Wort auf Welt Verursachungsrichtung. Man leistet der Anweisung Folge, das Gewicht auf den Talski zu legen. II 191 Bei zunehmender Geschicklichkeit ändert sich das. Die Anweisungen wirken unbewusst, aber immer noch als Repräsentation. Bewusst machen wird in Zukunft hinderlich wie beim Tausendfüßler. SearleVsTradition: die Regeln werden nicht verinnerlicht, sondern sie werden immer unwichtiger! Sie werden nicht unbewusst "fest verdrahtet" sondern sie gehen in Fleisch und Blut über. II 192 Vielleicht werden Sie als Nervenbahnen realisiert und machen die Regeln einfach überflüssig. Die Regeln können sich in den Hintergrund zurückziehen. Der Anfänger ist unflexibel, der Fortgeschrittene flexibel. Das macht die kausaler Rolle der Repräsentation hier überflüssig! Der Fortgeschrittene folgt nicht den Regeln besser, erfährt anders Ski! Der Körper übernimmt das Kommando und die Intentionalität des Fahrers wird auf den Rennsieg konzentriert. II 192/193 Hintergrund/Searle: befindet sich nicht an der Peripherie der Intentionalität, sondern durchdringt das ganze Netzwerk intentionaler Zustände. II 228 Name/Gegenstand/direkte Rede/Zitat/Tradition/Searle: Bsp der Sheriff äußerte die Worte »Mr. Howard ist ein ehrlicher Mann«. II 231 Nach der traditionellen Auffassung beinhaltet die wörtliche Rede hier überhaupt keine Wörter! (Sondern Namen.) II 232 SearleVsTradition: natürlich können wir mit Wörtern über Wörter sprechen. Außerdem werden hier keine neuen Namen geschaffen, die syntaktische Position erlaubt häufig nicht einmal die Einsetzung eines Namens. II 233 Bsp Gerald sagte, er werde Henry. (Ungrammatisch). II 246 de dicto/intensional/SearleVsTradition: Bsp "Reagan ist derart, dass Bush ihn für den Präsidenten hält." Searle: der Fehler bestand darin, aus der Intensionalität von de dicto-Berichten auf die Intensionalität der berichteten Zustände selbst zu schließen. Doch aus dem Vorhandensein zweier verschiedener Berichttypen folgt einfach nicht, dass es zwei verschiedene Arten von Zuständen gibt. III 165 Realismus/Tradition/Searle: die alte Streitfrage zwischen Realismus und Idealismus handelte von der Existenz der Materie oder von Objekten im Raum und Zeit. Der traditionelle Realismus beschäftigte sich mit der Frage, wie die Welt in Wirklichkeit ist. Realismus/SearleVsTradition: das ist ein tiefgreifendes Missverständnis! Der Realismus ist keine These darüber, wie die Welt tatsächlich ist. Wir könnten uns völlig im Irrtum darüber befinden, wie die Welt in allen ihren Einzelheiten ist, und der Realismus könnte immer noch wahr sein! Def Realismus/Searle: der Realismus ist die Ansicht, dass es eine Seinsweise der Dinge gibt, die von allen menschlichen Repräsentationen logisch unabhängig ist. Er sagt nicht, wie die Dinge sind, sondern nur, dass es eine Seinsweise der Dinge gibt. (Dinge hier nicht nur materielle Gegenstände). V 176 Prädikat/Bedeutung/Searle: aber ist die Bedeutung des Prädikatausdrucks eine sprachliche oder eine nichtsprachliche Entität? Searle: sie ist in einem ganz gewöhnlichen Sinne eine sprachliche Entität. Kann aus der Existenz einer sprachlichen Entität die Existenz einer nichtsprachlichen Entität folgen? Existenz/Sprache/Universalien/SearleVsTradition: aber die Behauptung, dass irgendwelche nichtsprachlichen Entitäten existieren, kann niemals eine Tautologie darstellen. IV 155 Hintergrund/Searle: was bedeutet "Anwendung" von Hintergrundannahmen? Der Bedeutungsbegriff soll für uns gewisse Aufgaben erledigen. Nun kann derselbe Gegenstand zu verschiedenen Zeiten relativ zu verschiedenen Koordinatensystem von Hintergrundannahmen verstanden werden, ohne mehrdeutig zu sein. ((s) Er ist in der jeweiligen Situation eindeutig). IV 156 SearleVsTradition: hier geht es auch nicht um die Unterscheidung Performanz/Kompetenz. IV 157 Es gibt keine scharfe Trennung zwischen der Kompetenz eines Sprechers und seinem Wissen über die Welt. |
Searle I John R. Searle Die Wiederentdeckung des Geistes Frankfurt 1996 Searle II John R. Searle Intentionalität Frankfurt 1991 Searle III John R. Searle Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit Hamburg 1997 Searle IV John R. Searle Ausdruck und Bedeutung Frankfurt 1982 Searle V John R. Searle Sprechakte Frankfurt 1983 Searle VII John R. Searle Behauptungen und Abweichungen In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Searle VIII John R. Searle Chomskys Revolution in der Linguistik In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Searle IX John R. Searle "Animal Minds", in: Midwest Studies in Philosophy 19 (1994) pp. 206-219 In Der Geist der Tiere, D Perler/M. Wild Frankfurt/M. 2005 |
| Kompetenz Sprache | Evans Vs Verschiedene | EMD II VIII Metasprache/Theoriesprache/Evans/McDowell: oft genannte Bedingungen: 1. wenn S bedeutungsvoll und unzweideutig ist, gibt es genau einen Satz von L, der für S eingetragen wird. 2. wenn S n fach mehrdeutig ist, gibt es n verschiedene Sätze von L, die für S eingetragen werden. 3. wenn S keine Bedeutung hat, gibt es keinen Satz von L, der für S eingetragen wird. 4. wenn S einen anderen Satz S’ beinhaltet (entails) gibt es eine effektiv entscheidbare Relation die zwischen dem Satz von L gilt, der für S bzw. für S’ eingetragen wird. Problem/Seuren: die 4. Bedingung führt zu einem begrifflichen Zusammenbruch! EMD II VIII/IX Bsp "John ist Junggeselle" beinhaltet (entails) "John ist unverheiratet". Gemäß der semantischen Repräsentation kann das einfache "Junggeselle" nicht dasselbe sein, wie das komplexe "unverheirateter Mann". Evans/McDowellVsSeuren: diese ganze Sache ist anfechtbar, nicht etwa, weil es die umstrittene Unterscheidung analytisch/synthetisch widerbelebt oder weil der "begriffliche Zusammenbruch" ohne Ende weiterginge, sondern, weil wir, wenn wir uns darauf einließen, in die Lage versetzt würden zu verhehlen, dass wir unfähig wären das zu tun, was wir tun. Und das wäre, dass wir etwas aufstellen, das, wenn es jemand wüsste, ihn in die Lage versetzte, eine Sprache zu sprechen und zu verstehen. Es wäre unfair, den Theoretikern zu unterstellen, sie wären sich der Sprecher Hörer Kompetenz nicht bewußt. Evans/McDowellVsSeuren: er suggeriert den Leuten, dass sie, wenn sie den "Zirkel durchbrechen", es zu der Unmöglichkeit führte, "außerhalb der Sprache" die Bedeutungen von Sätzen festzustellen, also "ohne Sprache zu gebrauchen". Vs: darin gibt es einen Fehlschluß: sicher können wir Bedeutungen nicht feststellen, ohne Wörter zu gebrauchen. Aber daraus folgt nicht daß, wenn wir die Satzbedeutung von S mit Hilfe des Satzes S’ angeben, EMD II X daß wir damit eine Relation zwischen S und S’ damit feststellen! Lösung: S wird erwähnt, und S’ wird gebraucht. (Gebrauch/Erwähnung, W Satz). Bsp (5) "Schnee ist weiß" ist wahr dann und nur dann, wenn Schnee weiß ist stellt keine Relation dar, die der Satz zu sich selbst hat, sondern stellt unter diesen Umständen eine semantische Eigenschaft des Satzes dar, indem sie ihn gebraucht. Das ist eine Exemplifikation, mit der wir sehr wohl unseren Glauben ausdrücken können, daß Schnee weiß ist. |
EMD II G. Evans/J. McDowell Truth and Meaning Oxford 1977 Evans I Gareth Evans "The Causal Theory of Names", in: Proceedings of the Aristotelian Society, Suppl. Vol. 47 (1973) 187-208 In Eigennamen, Ursula Wolf Frankfurt/M. 1993 Evans II Gareth Evans "Semantic Structure and Logical Form" In Truth and Meaning, G. Evans/J. McDowell Oxford 1976 Evans III G. Evans The Varieties of Reference (Clarendon Paperbacks) Oxford 1989 |
| Kompetenz Sprache | Horwich Vs Wittgenstein | Stegmüller IV 154 Meinen/Kripkes Wittgenstein/HorwichVsWittgenstein/HorwichVsKripke: Die Liste (s.o.) muss ergänzt werden: d) Mit "plus" die Addition zu meinen, schließt nicht aus, dass Fehler gemacht werden. Das darf von keinem Bedeutungsbegriff verletzt werden. e) Die Bedeutung von "plus" ist eine intrinsische Eigenschaft! Das steht aber im Widerspruch zu d)! Horwich: Gehirnuntersuchungen könnten übrigens Übereinstimmungen hervorbringen. Kripke und Wittgenstein haben zwar gezeigt, dass es keine Tatsachen des Meinens geben müsse, aber nicht, dass es keine geben könnte! IV 154/155 Stegmüller: Auch Wittgenstein würde eine Rückkehr zur Empirie sicher begrüßen, aber eine Theorie könnte die Übereinstimmung wohl als Tatsache feststellen (wie die Theorie von Chomsky) aber immer noch nur im Rahmen von Behauptbarkeitsbedingungen (Rechtfertigungsbedingungen), nicht im Sinne einer wahrheitsfunktionalen Semantik. Turingmaschine/Kripkes Wittgenstein/Stegmüller/Chomsky: Bsp (Kripke) Eine vom Himmel gefallene Maschine lässt sich in Bezug auf alles Relevante analysieren (Programm und Gedächtnis). a) Stegmüller: Damit akzeptiert Chomsky eine Auffassung, die eine geradlinige Lösung des Paradoxons enthält. Wir erkennen aufgrund von Unterschieden im Programm, ob "plus" oder "quus" repräsentiert ist. Denn wir verfügen über eine Theorie, die uns etwas über Unterschiede sagt. IV 156 b) Geradlinige Lösung: sprachliche Kompetenz: Wir unterscheiden wohlgeformte von nicht-wohlgeformten Lautbildungen. IV 157 "Schaltermodell"/internalisierte Sprache: Im strukturellen Urzustand mag es viele Schalter geben, die auf "Null" gestellt sind, und darauf warten, in aktive Positionen gebracht zu werden. Sprache ist nichts anderes als eine vorliegende stabile Schaltereinstellung (internalisierte Sprache). |
Horwich I P. Horwich (Ed.) Theories of Truth Aldershot 1994 |
| Kompetenz Sprache | Newen Vs Wittgenstein | New I 94 Gegenstand/Ding/Objekt/Tractatus/Wittgenstein/Newen: die Frage, welcher art die Gegenstände des Tractatus sind, ist bis heute umstritten: 1. James Griffin: einfache physikalische Teilchen 2. Hintikka: Punkte im Gesichtsfeld 3. H. Ishiguro: Exemplifikationen nicht weiter zurückführbarer Eigenschaften 4. Peter Carruthers: Alltagsgegenstände. Gegenstand/Tractatus/NewenVsTractatus/NewenVsWittgenstein/Newen: es gibt hier widersprüchliche Prinzipien, von denen eins aufgegeben werden muss, I 95 Damit die gegenstandsebene bestimmt werden kann: (i) Elementarsätze haben die Form "Fa", "Rab"… es werden externe Eigenschaften zugeschrieben. (ii) externe und interne Eigenschaften verhalten sich zueinander wie verschiedene Dimensionen Bsp Längen und Farben. (iii) Elementarsätze sind logisch unabhängig. Problem: dann kann der Wahrheitswert eines Satzes "Ga" von dem eines Satzes "Fa" abhängen. Bsp ein Punkt kann nicht zugleich rot und blau sein. Pointe: dann sind die Sätze aber nicht mehr unabhängig. Wittgenstein/VsWittgenstein/Selbstkritik/Newen: Wittgenstein selbst bemerkte das 1929 im Aufsatz Some remarks on Logical Form. I 98 Elementarsatz/Tractatus/Wittgenstein/Newen: Sätze über Punkte im Gesichtsfeld oder physikalische Teilchen sind dort keine Elementarsätze, weil sie nicht unabhängig sein können ((s) Widersprechende Eigenschaften müssen ausgeschlossen werden können). I 99 Mittlerer Wittgenstein: erkennt in der Abhängigkeit eine Grundstruktur, die nicht beseitigt werden kann. Bsp "Was blau ist, ist nicht rot". Satzbedeutung/PU/Wittgenstein/Newen: die Bedeutung von Sätzen kann also nicht nur durch die Vertretungsrelation von Namen gewährleistet sein. Abbildtheorie/WittgensteinVsWittgenstein/Selbstkritik/Wittgenstein/Newen: die AT muss also revidiert werden. 100 mittlerer Wittgenstein/Newen. These: die Bedeutung von Zeichen wird durch die syntaktischen regeln seines Sprachsystems festgelegt. VsWittgenstein/Newen: die Frage, wie diese syntaktischen Regeln festgelegt sind, wird hier noch nicht beantwortet. NS I 35 Regelfolgen/Wittgenstein: ist, einer Gepflogenheit gemäß zu handeln. Ohne Begründung oder Überlegung. Es ist schlicht eine Kompetenz, auf eine erlernte, übliche und selbstverständliche Weise zu handeln. Gepflogenheiten/Konvention: Gepflogenheiten sind nicht deshalb gültig, weil sie festgesetzt oder vereinbart wurden, sondern weil sich üblicherweise alle daran gebunden fühlen. Das gilt auch für regeln, die die Bedeutung eines sprachlichen Zeichens festlegen. ((s) Regeln/(s): legen also etwas fest, sind aber selbst nicht festgelegt, sondern eingespielt und stabil.) NS I 36 VsWittgenstein/Newen/Schrenk: Problem: die Unbestimmtheit der Verwendungsweisen. Es gibt auch Fehlverwendungen, die als bedeutungskonstituierend einbezogen werden müssten. Sie können sehr verbreitet sein. VsWittgenstein/Newen/Schrenk: Problem: Holismus der Gebrauchsweisen: wenn eine einzige neue Verwendungsweise eingeführt wird, müsste sich die Bedeutung des Ausdrucks ändern. NS I 37 Käfer-Bsp/Privatsprache/Wittgenstein/Newen/Schrenk: der Ausdruck „Käfer“ kann eine klare Verwendung haben, selbst wenn jeder einen anderen Käfer in seiner Schachtel und selbst, wenn die Schachtel leer ist! Wittgenstein: selbst wenn sich das Ding fortwährend veränderte. Das Ding in der Schachtel gehört überhaupt nicht zum Sprachspiel. Auch nie einmal als ein Etwas. (§ 293). Newen/Schrenk. das zeigt, dass die Bedeutung eines Ausdrucks nicht dadurch festgelegt wird, dass wir eine Empfindung haben, sondern durch die Praxis in einer Gemeinschaft. Eine Person allein kann Ausdrücken keine Bedeutung verleihen. NS I 38 Newen/Schrenk VsWittgenstein: Bsp Robinson kann aber durch eine Regelmäßigkeit der Beschaffenheit Wörter für Ananas usw. einführen. WittgensteinVsVs/Newen/Schrenk: würde einwenden, 1. dass Robinson keine Gepflogenheiten etablieren kann, weil er nicht merken würde, wenn er davon abweicht. Dann gäbe es keinen Unterschied mehr zwischen folgen und zu folgen glauben. VsVs/Newen/Schrenk: 2. ein weiterer Einwand wäre, dass Robinson nur Kategorien bilden kann, weil er in seiner Gemeinschaft gelernt hat, wie man Kategorien bildet. |
New II Albert Newen Analytische Philosophie zur Einführung Hamburg 2005 Newen I Albert Newen Markus Schrenk Einführung in die Sprachphilosophie Darmstadt 2008 |
Der gesuchte Begriff oder Autor findet sich in folgenden Thesen von Autoren des zentralen Fachgebiets.
| Begriff/ Autor/Ismus |
Autor |
Eintrag |
Literatur |
|---|---|---|---|
| Kompositionalit. | Soames, Sc. | Schiffer I 217 kompositionale Semantik/Verstehen/Erklärung/Scott Soames/Schiffer: (Soames 1987) These kS wird nicht für das Erklären des Spracheverstehens gebraucht, dennoch haben natürliche Sprachen eine kS: Sprachbeherrschung/Soames: man sollte nicht auf die Semantik schauen, um semantische Kompetenz zu erklären. Statt dessen braucht man kS für die Erklärung des repräsentationalen Charakters der Sprache. Die zentrale semantische Tatsache über Sprache ist, daß sie gebraucht wird, um die Welt zu repräsentieren. Sätze kodieren systematisch Information, die die Welt so und so charakterisieren. Wir brauchen sK für die Analyse der Prinzipien dieser Kodierung. SchifferVsSoames: statt dessen habe ich das Ausdrucks-Potential eingeführt. Man könnte annehmen, daß eine endlich formulierbare Theorie Theoreme für die Zuschreibung von AP zu jedem Satz der Sprache formulieren können sollte. Aber wäre das nicht dann eine kompositionale Theorie? |
Schi I St. Schiffer Remnants of Meaning Cambridge 1987 |