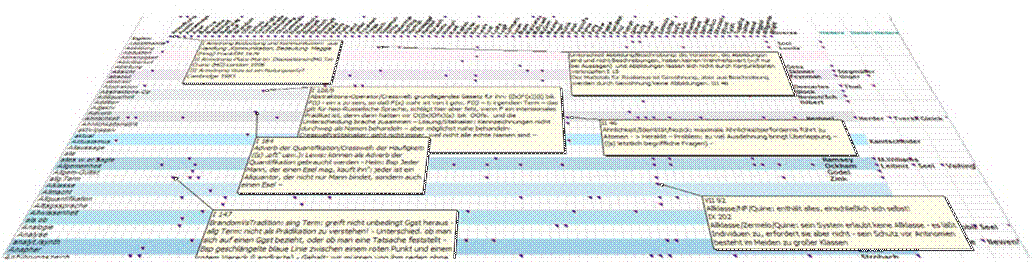Finden Sie Gegenargumente, in dem Sie NameVs…. oder….VsName eingeben.
| Begriff/ Autor/Ismus |
Autor Vs Autor |
Eintrag |
Literatur |
|---|---|---|---|
| Notwendigkeit a posteriori | Stalnaker Vs Chalmers, D. | I 194 Semantische Tatsachen/Semantik/Stalnaker: die Semantik nimmt an, dass die semantischen Tatsachen, über eine Sprache, die zwei Arten von Intensionen festlegt, die von eben diesen semantischen Tatsachen abstrahiert werden können und dann auch in möglichen Welten (MöWe) angewendet werden können, in denen diese Tatsachen nicht bestehen. Wir können die primäre Intension in der aktualen Welt (WiWe) nehmen und ihre Extension in einer beliebigen MöWe betrachten. Metasemantik/Stalnaker: nimmt nur an, dass die Semantik (plus Kontext) I 195 eine normale Intension festlegt. Also nimmt sie weniger an, was von einer Semantik für eine Sprache abgeleitet werden kann. primäre Intension/Metasemantik/Stalnaker: hier haben diese Funktionen einen eingeschränkteren Bereich. Ihre Werte sind nur für solche MöWe bestimmt, die diesen Ausdruck (das Token) enthalten. Semantik/Metasemantik/Chalmers: diese Unterscheidung macht wenig Unterschied. StalnakerVsChalmers: doch: es geht nicht nur darum, wie man die verschiedenen Repräsentationen, wie Referenten von den Tatsachen abhängen unterscheidet, die Unterscheidung reflektiert zwei verschiedene Weisen, den zwei-dimensionalen Apparat zu nutzen. Unterschied: a) wir charakterisieren die relevanten zwei-dimensionalen und primären Intensionen als Arten von Bedeutung, b) nicht als Bedeutung. Stalnaker: das hat Konsequenzen für unser Verständnis von a priori Wissen und Wahrheit. I 202 Notwendig a posteriori: ist danach aufteilbar in notwendige Wahrheit die a priori wißbar ist durch begriffliche Analyse, und einen Teil, der nur a posteriori wißbar ist, aber dieser ist kontingent. Das zeigen Chalmers und Jackson mit zwei-dimensionaler Semantik. Stalnaker: ich stimme mit den beiden überein, dass dieses Phänomen seine Wurzeln in der Relation zwischen Weise hat, wie wir die Welt repräsentieren und der Welt selbst, aber Zwei-dimensionale Semantik/StalnakerVsJackson/StalnakerVsChalmers: These: ich denke, das zeigt etwas über die Natur mentaler Repräsentation und nicht nur über das kontingente Funktionieren von Sprachen. I 210 Zwei-dimensionaler Rahmen/Stalnaker: kann interpretiert werden a) wie Kaplan ursprünglich, aber erweitert b) metasemantisch. I 211 Ad a) dann sind die Kausalketten Teil des semantischen Gehalts Chalmers: das macht wenig Unterschied StalnakerVsChalmers: der Unterschied ist größer als er denkt. Notwendigkeit a posteriori wird dann verschieden analysiert. Kausalkette/Stalnaker: wenn sie Teil der deskriptiven Semantik ist, dann wird damit gesagt, wie – gegeben diese deskriptive Semantik – die Referenten durch die Tatsachen festgelegt sind. Problem: wie bestimmten die Tatsachen, welche Semantik die Sprache hat? |
Stalnaker I R. Stalnaker Ways a World may be Oxford New York 2003 |
| Notwendigkeit a posteriori | Kripke Vs Hume, D. | I 45 Apriori: einige Philosophen ändern die Modalitäten in dieser Charakterisierung irgendwie von "kann" in "muss" . Sie denken, dass etwas wenn es zum Bereich der apriorischen Erkenntnis gehört, unmöglich empirisch erkannt werden kann. (Hume). Das ist schlicht falsch! (KripkeVsHume). Bsp der Computer kann eine Antwort auf die Frage geben, ob die und die Zahl eine Primzahl ist. Niemand hat das berechnet oder bewiesen, aber der Computer hat die Antwort gegeben. I 181 A posteriori: man kann eine mathematische Wahrheit a posteriori erfahren, indem man einen Computer ansieht oder auch indem man einen Mathematiker fragt. (Bsp notwendig a posteriori). Die philosophische Analyse sagt uns, dass sie nicht kontingent war sein können, und daher ist jede empirische Erkenntnis ihrer Wahrheit automatisch eine empirische Erkenntnis ihrer Notwendigkeit. (KripkeVsHume, KripkeVsKant). |
Kripke I S.A. Kripke Name und Notwendigkeit Frankfurt 1981 Kripke II Saul A. Kripke "Speaker’s Reference and Semantic Reference", in: Midwest Studies in Philosophy 2 (1977) 255-276 In Eigennamen, Ursula Wolf Frankfurt/M. 1993 Kripke III Saul A. Kripke Is there a problem with substitutional quantification? In Truth and Meaning, G. Evans/J McDowell Oxford 1976 Kripke IV S. A. Kripke Outline of a Theory of Truth (1975) In Recent Essays on Truth and the Liar Paradox, R. L. Martin (Hg) Oxford/NY 1984 |
| Notwendigkeit a posteriori | Schwarz Vs Jackson, Frank | Schwarz I 226 a posteriori Notwendigkeit/SchwarzVLewis/SchwarzVsJackson: daraus folgt aber nicht, dass wenn die physikalischen Wahrheiten alles andere notwendig implizieren – wenn sie eine metaphysische Basis für alle Wahrheiten über die aktuale Situation bilden dass diese Implikation dann auch a priori sein muss. Es könnte sein, dass die metaphysische Basis auch nur a posteriori impliziert: Bsp der Satz „alles ist so wie es tatsächlich ist“. Impliziert notwendig alle Wahrheiten, er ist nur in der wirklichen Welt (WiWe) wahr. A priori impliziert er gar nichts! ((s) Er ist nicht für alle MöWe wahr, aber in jeder MöWe für sich genommen doch). >Panpsychismus: Panpsychismus/Panprotopsychismus/Chalmers/Schwarz: (Chalmers 2002) macht sich diese Lücke zunutze: Ausgangspunkt ist eine Art Def Quidditismus (s.o. 5.4): These: unsere physikalischen Theorie beschreiben, wie physikalische Dinge und Eigenschaften sich zueinander verhalten, was sie sind, ihre intrinsische Natur, lassen sie aber im Dunkeln. Def Pan(proto)psychismus: These: diese intrinsische Natur der Dinge und Eigenschaften ist mental. Bsp was wir gleichsam von außen als Ladung –1 kennen, entpuppt sich von innen als Schmerz. ((s) > Zwei Aspekte- Lehre). Wenn nun unser physikalisches Vokabular starr ist, (d.h. sich auch im Bereich von Modaloperatoren stets auf das bezieht, was bei uns die kausal strukturelle Rolle spielt (also auf Schmerz), dann implizieren die physikalischen Wahrheiten notwendig die mentalen, aber die Implikation braucht nicht a priori zu sein. Problem: die physikalischen Wahrheiten sind nicht hinreichend, um uns genau zu sagen, in welcher Situation wir uns befinden, vor allem was die intrinsische Natur der physikalischen Größen angeht. |
Schw I W. Schwarz David Lewis Bielefeld 2005 |
| Notwendigkeit a posteriori | Kripke Vs Kant | I 135 Kant: "alle analytischen Urteile beruhen gänzlich auf dem Satze des Widerspruchs und sind ihrer Natur nach Erkenntnisse apriori, die Begriffe, die ihnen zur Materie dienen, mögen empirisch sein, oder nicht. Denn weil das Prädikat schon vorher im Begriffe des Subjekts gedacht wird, so kann es nicht von ihm verneint werden." I 181 Eben darum sind auch alle analytischen Sätze Urteile apriori, wenngleich ihre Begriffe empirisch ist sind. Bsp Gold ist ein gelbes Metall. Denn um dieses zu wissen, brauche ich keiner weiteren Erfahrung außer meinem Begriff vom Gold. Wenn das macht eben meinem Begriff diesen Begriff kann ich nur zergliedern, ich kann mich nicht anderswo danach umsehen. Kripke: Kant scheint hier zu sagen, daß Gold einfach gelbes Metall bedeutet. KripkeVsKant: Hat Kant hierin Recht? Nach Angaben von Wissenschaftlern ist es sehr schwer zu sagen, was ein Metall ist. Wir brauchen auch Kenntnisse über das Periodensystem. Man könnte zur Meinung kommen, es handele sich in Wirklichkeit um zwei Begriffe, einen phänomenologischen und einen wissenschaftlichen, der ihn dann ersetzt. Phänomenologisch: Dehnbar,verformbar, wissenschaftlich: Periodensystem. (Kripke versus). a posteriori: man kann eine mathematische Wahrheit a posteriori erfahren, indem man einen Computer ansieht oder auch indem man einen Mathematiker fragt. (Bsp notwendig a posteriori). Die philosophische Analyse sagt uns, dass sie nicht kontingent war sein können, und daher ist jede empirische Erkenntnis ihrer Wahrheit automatisch eine empirische Erkenntnis ihrer Notwendigkeit. (KripkeVsHume, KripkeVsKant). |
Kripke I S.A. Kripke Name und Notwendigkeit Frankfurt 1981 Kripke II Saul A. Kripke "Speaker’s Reference and Semantic Reference", in: Midwest Studies in Philosophy 2 (1977) 255-276 In Eigennamen, Ursula Wolf Frankfurt/M. 1993 Kripke III Saul A. Kripke Is there a problem with substitutional quantification? In Truth and Meaning, G. Evans/J McDowell Oxford 1976 Kripke IV S. A. Kripke Outline of a Theory of Truth (1975) In Recent Essays on Truth and the Liar Paradox, R. L. Martin (Hg) Oxford/NY 1984 |
| Notwendigkeit a posteriori | Lewis Vs Kripke, Saul A. | V 251/252 Ereignis/Kennzeichnung/Beschreiben/Benennen/Lewis: Ein Ereignis wird meist durch akzidentelle Eigenschaften spezifiziert. Auch wenn es sogar klar ist, was es bedeutete, es durch sein Wesen zu spezifizieren. Ein Ereignis trifft z.B. auf eine Kennzeichnung zu, hätte sich aber auch ereignen können, ohne auf die Beschreibung zuzutreffen. Def Ereignis/Lewis: Ein Ereignis ist eine Klasse, die aus einer Region dieser Welt zusammen mit verschiedenen Regionen von anderen möglichen Welten (MöWe) besteht, in denen sich das Ereignis hätte ereignen können (weil Ereignisse immer kontingent sind). Was der Beschreibung in einer Region entspricht, entspricht ihr nicht in einer anderen Region (einer anderen Welt). Man kann nie ein vollständiges Inventar der möglichen Beschreibungen (Kennzeichnungen) eines Ereignisses erreichen. 1. Künstliche Beschreibung: Bsp "das Ereignis, das im Urknall besteht wenn Essendon das Endspiel gewinnt, aber die Geburt von Calvin Coolidge, wenn nicht", "p > q, sonst r". 2. Teils durch Ursache oder Wirkungen. 3. Durch Referenz auf den Ort in einem System von Konventionen Bsp Unterschreiben des Schecks. 4. Vermischung von wesentlichen und akzidentellen Elementen: Singen, während Rom brennt. Bsp Tripel Eigenschaft, Zeit, Individuum, (s.o.). 5. Spezifikation durch einen Zeitpunkt, obwohl das Ereignis auch früher oder später hätte vorkommen können. 6. Obwohl Individuen wesentlich involviert sein können, können akzidentell zugehörige Individuen herausgehoben werden. 7. Es kann sein, dass ein reiches Wesen eines Ereignisses darin besteht, zu schlendern, aber ein weniger fragiles (beschreibungsabhängiges) Ereignis könnte lediglich akzidentell ein Schlendern sein. ((s) Und es kann unklar bleiben, ob das Ereignis nun wesentlich durch Schlendern charakterisiert ist.) 8. Ein Ereignis, das ein Individuum wesentlich involviert, mag gleichzeitig akzidentell ein anderes Involvieren: Bsp ein bestimmter Soldat, der zufällig zu einer bestimmten Armee gehört. Das entsprechende Ereignis kann nicht in Regionen vorkommen, wo es kein Gegenstück zu diesem Soldat gibt, wohl aber, wenn es ein Gegenstück von dem Soldaten gibt, dieses aber zu einer anderen Armee gehört. V 253 Dann wird die Armee akzidentell involviert, über die Weise ihres Soldaten. 9. Wärme: nicht-starrer Designator (nonrigid): (LewisVsKripke): Nicht starr: Was immer diese Rolle hat oder was immer die und die Manifestation hervorbringt ist nicht starr. Bsp Wärme hätte auch etwas anderes als Molekülbewegung sein können. Lewis: In einer Welt, wo Wärmefluss die entsprechenden Manifestationen hervorbringt, sind heiße Dinge solche, die eine Menge Wärmefluss haben. --- Schwarz I 55 Wesen/Kontextabhängigkeit/LewisVsKripke/SchwarzVsKripke: In bestimmen Kontexten können wir durchaus fragen, Bsp wie es wäre, wenn wir andere Eltern gehabt hätten oder einer anderen Art angehörten. Bsp Statue/Ton: Angenommen, Statue und Ton existieren beide genau gleich lang. Sollen wir dann sagen, dass sie es trotz ihrer materiellen Natur schaffen, stets zur selben Zeit am selben Ort zu sein? Sollen wir sagen, dass beide gleich viel wiegen, aber zusammen nicht doppelt? Problem: Wenn man sagt, dass die beiden identisch sind, bekommt man Ärger mit den modalen Eigenschaften: Bsp Das Stück Lehm hätte auch ganz anders geformt sein können, die Statue aber nicht. Umgekehrt: I 56 Bsp Die Statue hätte aus Gold bestehen können, aber der Ton hätte nicht aus Gold bestehen können. Gegenstück Theorie/GT/Identität: Lösung: Die relevante Ähnlichkeitsrelation hängt davon ab, wie wir auf das Ding Bezug nehmen, als Statue oder als Lehm. Gegenstück Relation: Kann (anders als Identität) nicht nur vage und variabel, sondern auch asymmetrisch und intransitiv sein. (1968(1),28f): Das ist die Lösung für Def Chisholms Paradox/Schwarz: (Chisholm, 1967(2)): Bsp Angenommen, Kripke könnte unmöglich ein Rührei sein. Aber sicher könnte er ein wenig rühreiartiger sein, wenn er ein wenige kleiner und gelber wäre! Und wäre er ein bisschen mehr so, dann könnte er auch noch mehr so sein. Und es wäre seltsam, wenn er in jener Welt nicht wenigstens ein kleines bisschen kleiner und gelber sein könnte. GT/Lösung: Weil die Gegenstückrelation intransitiv ist, folgt aber keineswegs, dass am Ende Kripke ein Rührei ist. Ein Gegenstück eines Gegenstücks von Kripke muss nicht ein Gegenstück von Kripke sein (1986e(3), 246). I 57 KripkeVsGegenstück-Theorie/KripkeVsLewis: Bsp Wenn wir sagen „Humphrey hätte die Wahl gewinnen können“ reden wir nach Lewis eben nicht von Humphrey, sondern von jemand anderem. Und nichts könnte ihm gleichgültiger sein („he couldn’t care less“). (Kripke 1980(4), 44f). Gegenstück/Gegenstücktheorie/SchwarzVsKripke/SchwarzVsPlantinga: Die beiden Einwände missverstehen Lewis. Lewis behauptet nicht, dass Humphrey die Wahl nicht hätte gewinnen können, im Gegenteil: „er hätte die Wahl gewinnen können“ steht genau für die Eigenschaft, die jemand hat, wenn eins seiner Gegenstücke die Wahl gewinnt. Diese Eigenschaft hat Humphrey, kraft seines Charakters (1983d(5),42). Eigentliches Problem: Wie macht Humphrey das, dass er in der und der möglichen Welt die Wahl gewinnt? Plantinga: Humphrey hätte gewonnen, wenn der entsprechenden Welt (dem Sachverhalt) die Eigenschaft des Bestehens zukäme. Lewis/Schwarz: Diese Frage hat mit den Intuitionen auf die sich Kripke und Plantinga berufen, nichts zu tun. --- Schwarz I 223 Namen/Kennzeichnung/Referenz/Kripke/Putnam/Schwarz: (Kripke 1980(4), Putnam 1975(6)): These: Für Namen und Artausdrücke gibt es keine allgemeinbekannte Beschreibung (Kennzeichnung), die festlegt, worauf der Ausdruck sich bezieht. These: Kennzeichnungen sind für die Referenz völlig irrelevant. Beschreibungstheorie/LewisVsKripke/LewisVsPutnam/Schwarz: Das widerlegt nur die naive Kennzeichnungstheorie, nach der biographische Taten aufgelistet werden, die dem Referenten notwendig zukommen sollen. Lösung/Lewis: Seine Beschreibungstheorie der Namen erlaubt, dass Bsp „Gödel“ nur eine zentrale Komponente hat: nämlich dass Gödel am Anfang der Kausalkette steht. Damit steht die Theorie nicht mehr im Widerspruch zur Kausaltheorie der Referenz (1984b(7), 59, 1994b(8), 313, 1997c(9), 353f, Fn22). ((s)Vs: Aber nicht die Kennzeichnung „steht am Anfang der Kausalkette“, denn das unterscheidet einen Namen nicht von irgendeinem anderen. Andererseits: „Am Anfang der Gödel Kausalkette“ wäre nichtssagend.) Referenz/LewisVsMagische Theorie der Referenz: Nach dieser Theorie ist Referenz eine primitive, irreduzible Beziehung (vgl. Kripke 1980(4), 88 Fn 38), sodass wir, selbst wenn wir alle nicht semantischen Tatsachen über uns und die Welt wüssten, immer noch nicht wüssten, worauf unsere Wörter sich beziehen, nach der wir dazu spezielle Referenz-o-Meter bräuchten, die fundamentale semantische Tatsachen ans Licht bringen. Wenn die magische Theorie der Referenz falsch ist, dann genügt nicht semantische Information im Prinzip, um uns zu sagen, worauf wir uns mit Bsp „Gödel“ beziehen: "Wenn die Dinge so und so sind, bezieht sich „Gödel“ auf den und den". Daraus können wir dann eine Kennzeichnung konstruieren, von der wir a priori wissen, dass sie Gödel herausgreift. Diese Kennzeichnung wird oft indexikalische oder demonstrative Elemente enthalten, Verweise auf die wirkliche Welt. I 224 Referenz/Theorie/Namen/Kennzeichnung/Beschreibungstheorie/LewisVsPutnam/LewisVsKripke/Schwarz: Bsp unsere Bananen-Theorie sagt nicht, dass Bananen zu allen Zeiten und in allen möglichen Welten im Supermarkt verkauft werden. Bsp unsere Gödel-Theorie sagt nicht, dass Gödel in allen möglichen Welten Gödel heißt. ((s) >Deskriptivismus). (KripkeVsLewis: doch: Namen sind starre Designatoren). LewisVsKripke: Bei der Auswertung von Namen im Bereich von Temporal- und Modaloperatoren muss man berücksichtigen, was in der Äußerungssituation die Kennzeichnung erfüllt, nicht in der Welt oder in der Zeit, von der gerade die Rede ist (1970c(12), 87, 1984b(8), 59, 1997c(9), 356f). I 225 A posteriori Notwendigkeit/Kripke/Schwarz: Könnte es nicht sein, dass Wahrheiten über Schmerzen zwar auf physikalisch biologischen Tatsachen supervenieren und damit notwendig aus diesen folgen, dass uns diese Beziehung aber nicht a priori oder durch Begriffsanalyse zugänglich ist? Die Reduktion von Wasser auf H2O ist schließlich nicht philosophisch, sondern wissenschaftlich. Schwarz: Wenn das stimmt, macht sich Lewis die Arbeit unnötig schwer. Als Physikalist müsste er nur behaupten, dass phänomenale Begriffe in nicht phänomenalem Vokabular analysierbar sind. Man könnte auch die Analyse von Naturgesetzen und Kausalität sparen. Er könnte einfach behaupten, diese Phänomene folgten notwendig a posteriori aus der Verteilung lokaler physikalischer Eigenschaften. a posteriori notwendig/LewisVsKripke: Das ist inkohärent, dass ein Satz a posteriori ist, heißt, dass man Information über die aktuelle Situation braucht, um herauszufinden, ob er wahr ist. Bsp Dass Blair der tatsächliche Premierminister ist (tatsächlich eine a posteriori Notwendigkeit) muss man wissen, dass er in der aktuellen Situation Premierminister ist,.. I 226 ...was wiederum eine kontingente Tatsache ist. Wenn wir genügend Information über die ganze Welt haben, könnten wir im Prinzip a priori entnehmen, dass Blair der tatsächliche Premierminister ist. a posteriori Notwendigkeiten folgen a priori aus kontingenten Wahrheiten über die aktuelle Situation. (1994b(8), 296f, 2002b(10), Jackson 1998a(11): 56-86), s.o. 8.2) 1. David Lewis [1968]: “Counterpart Theory and Quantified Modal Logic”. Journal of Philosophy, 65:113–126. 2. Roderick Chisholm [1967]: “Identity through Possible Worlds: Some Questions”. Noˆus, 1:1–8. 3. David Lewis [1986e]: On the Plurality of Worlds. Malden (Mass.): Blackwell. 4. Saul A. Kripke [1980]: Naming and Necessity. Oxford: Blackwell. 5. David Lewis [1983d]: Philosophical Papers I . New York, Oxford: Oxford University Press. 6. Hilary Putnam [1975]: “The Meaning of ‘Meaning’ ”. In [Gunderson 1975], 131–193. 7. David Lewis [1984b]: “Putnam’s Paradox”. Australasian Journal of Philosophy, 61: 343–377. 8. David Lewis [1994b]: “Reduction of Mind”. In Samuel Guttenplan (Hg.), A Companion to the Philosophy of Mind, Oxford: Blackwell, 412–431. 9. David Lewis [1997c]: “Naming the Colours”. Australasian Journal of Philosophy, 75: 325–342. 10. David Lewis [2002b]: “Tharp’s Third Theorem”. Analysis, 62: 95–97. 11. Frank Jackson [1998a]: From Metaphysics to Ethics: A Defence of Conceptual Analysis. Oxford: Clarendon Press. 12. David Lewis [1970c]: “How to Define Theoretical Terms”. Journal of Philosophy, 67: 427–446. |
Lewis I David K. Lewis Die Identität von Körper und Geist Frankfurt 1989 Lewis I (a) David K. Lewis An Argument for the Identity Theory, in: Journal of Philosophy 63 (1966) In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis I (b) David K. Lewis Psychophysical and Theoretical Identifications, in: Australasian Journal of Philosophy 50 (1972) In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis I (c) David K. Lewis Mad Pain and Martian Pain, Readings in Philosophy of Psychology, Vol. 1, Ned Block (ed.) Harvard University Press, 1980 In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis II David K. Lewis "Languages and Language", in: K. Gunderson (Ed.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol. VII, Language, Mind, and Knowledge, Minneapolis 1975, pp. 3-35 In Handlung, Kommunikation, Bedeutung, Georg Meggle Frankfurt/M. 1979 Lewis IV David K. Lewis Philosophical Papers Bd I New York Oxford 1983 Lewis V David K. Lewis Philosophical Papers Bd II New York Oxford 1986 Lewis VI David K. Lewis Konventionen Berlin 1975 LewisCl Clarence Irving Lewis Collected Papers of Clarence Irving Lewis Stanford 1970 LewisCl I Clarence Irving Lewis Mind and the World Order: Outline of a Theory of Knowledge (Dover Books on Western Philosophy) 1991 Schw I W. Schwarz David Lewis Bielefeld 2005 |
| Notwendigkeit a posteriori | Inwagen, Vs Lewis, David | Schwarz I 227 Metaphysik/Wesen/wesentlich/van InwagenVsLewis/StalnakerVsLewis: Wissen über kontingente Tatsachen über die aktuelle Situation wäre prinzipiell nicht hinreichend, um alle a posteriori Notwendigkeiten zu kennen: Def starke Notwendigkeit/Chalmers: These: Neben substantiellen kontingenten Wahrheiten gibt es auch substantielle modale Wahrheiten: Bsp dass Kripke essentiell ein Mensch ist, Bsp dass Schmerz essentiell identisch mit XY ist. Pointe: Kenntnis kontingenter Tatsachen ist nicht hinreichend, um diese modalen Tatsachen zu erkennen. Wie erkennen wir sie, vielleicht können wir das nicht (van Inwagen 1998)(1) oder nur hypothetisch durch methodologische Erwägungen (Block/Stalnaker 1999)(2). 1. Peter van Inwagen [1998]: “Modal Epistemology”. Philosophical Studies, 92: 67–84. 2. Ned Block und Robert Stalnaker [1999]: “Conceptual Analysis, Dualism, and the Explanatory Gap”. The Philosophical Review, 108: 1–46. |
Schw I W. Schwarz David Lewis Bielefeld 2005 |
| Notwendigkeit a posteriori | Stalnaker Vs Quine, W.V.O. | I 71 Essentialismus/heute/VsQuine: die meisten Modallogiker heute widersprechen Quine und akzeptieren die Verbindung zwischen Modallogik und Essentialismus und akzeptieren auch den Essentialismus. Statt wie damals Quine zu sagen: "um so schlimmer für quantifizierte ML" sagen sie: "um so besser für den Essentialismus". I 72 Wesen/Essentialismus/wesentliche Eigenschaft/LeibnizVsQuine/Stalnaker: widersprach Quine auf die erste Weise: These: jede Eigenschaft jedes Individuums konstituiert sein Wesen und nur die Existenz des Dings als ganze ist kontingent. heute: David Lewis mit seiner Gegenstück-Theorie ist ein moderner Nachfolger von Leibniz. Gegenstück/Lewis: Dinge der aktualen Welt (WiWe) haben Gegenstücke in anderen möglichen Welten (MöWe). Dinge, die ihnen mehr ähneln als jedes andere Ding. Daher kann kein Individuum akzidentelle Eigenschafen haben, Eigenschaften, die ihm in anderen MöWe abgehen. I 201 Quine/Stalnaker: lehrte uns skeptisch zu sein in Bezug auf die Idee von Notwendigkeit, Analytizität und Wissen a priori. Er stellte allerdings nicht die empiristische Annahmen in Frage, dass diese Begriffe miteinander stehen und fallen. KripkeVsQuine/Stalnaker: erst Kripke zog diese Begriffe auseinander, indem er Beispiele fand für Wahrheiten, die notwendig sind, obwohl sie erst a posteriori wissbar sind und solche, die kontingent, aber dennoch a priori wissbar sind. II 24 Glauben/Mentalesisch/Field/Stalnaker: seine These war, die intentional-psychologische Relation in eine psychologische, aber nicht-intentionale und eine semantische aber nicht-psychologische Relation - zwischen einem Satz und der ausgedrückten Proposition – umzudeuten. Glaubenszuschreibung/Quine/Stalnaker: sein Ziel war es, die Zuschreibung zu verallgemeinern. Damit sollte eine Verpflichtung auf singuläre Propositionen vermieden werden. StalnakerVsQuine: das Projekt ändert aber seinen Charakter, wenn es um den allgemeinen Fall geht. De re-Zuschreibung/Stalnaker: sollte besser nicht als indirekt und unbestimmt angesehen werden, II 25 sondern einfach als Beispiele, die wesentliche Merkmale des Intentionalen zeigen: Zuschreibung: wenn wir intentionale Zustände zuschreiben, die Arten, Eigenschaften und Relationen, auf die wir dabei referieren finden wir in der Welt und mit ihnen charakterisieren wir die Welt, wie jemand sie sieht. Pointe: das ist eben keine indirekte, sondern ein direkte Weise, zum Inhalt zu gelangen. II 160 Def Singuläre Proposition/Stalnaker: hier Bsp eine singuläre Proposition schreibt Ortcutt Spionsein zu. strukturierte singuläre Proposition/Stalnaker: (für jene, für die Propositionen strukturierte Entitäten sind): dann sind singuläre Propositionen solche, die ein Individuum als Konstituente haben. (StalnakerVsStrukturierte Propositionen). Singuläre Proposition/MöWe-Semantik/Semantik möglicher Welten/Stalnaker: für jene, für die Propositionen Mengen von MöWe sind, (Stalnaker pro)): dann ist eine singuläre Proposition eine Proposition, deren Wahrheit von den Eigenschaften eines bestimmten Individuums abhängt. Singuläre Proposition/Stalnaker: die Identität einer singulären Proposition ist eine Funktion eines Individuums statt eines Begriffs oder der Gegebenheitsweise eines Individuums. StalnakerVsQuine: dieser semantische Ansatz ist einfacher und weniger ad hoc als der von Quine. II 161 De re/Zuschreibung/Glauben de re/singuläre Proposition/sing Prop/StalnakerVsQuine/Stalnaker : der semantische Ansatz fasst die Zuschreibung eines Glaubens de re dann als Zuschreibung eines ganz bestimmten Glaubens auf (anders als Quine). Was heißt es, eine singuläre Proposition zu glauben? Wie ist es zu glauben, dass Ortcutt selbst ein Spion ist? Und nicht bloß, dass die Person eine Kennzeichnung erfült, oder einem Glaubenssubjekt in einer gewissen Weise gegeben ist? Problem: Angenommen, Ralph kennt Ortcutt auf zwei verschiedenen Weisen (Strand, brauner Hut). Welche singuläre Proposition über Ortcutt glaubt er? schlechte Lösung: viele Autoren denken, es müsste hier eine spezielle Relation der Bekanntschaft geben. Bekanntschaft/Stalnaker: Problem: eine semantische Relation für sie anzugeben. 1. die erste Strategie macht Glauben de re dann zu einfach: Bsp Poirot glaubt, dass es der Butler war einfach aufgrund der beiden Tatsache, dass 1. der Butler es war und 2. Poirot glaubt, dass es die Person war, die’s war. 2. die zweite Strategie macht Glauben de re zu schwierig: dann hat Ralph, der mit Ortcutt bekannt ist, zwei widersprüchliche Überzeugungen. Lösung: a) die Relation der Bekanntschaft stärken, so da Fehlidentifikationen unmöglich sind. Vs: solche Fehler sind fast immer möglich! Dann könnte man nur noch de re-Überzeugungen über sich selbst haben. b) das "Teile-und-herrsche"-Argument: wir erzählen die Geschichte von Ralph in zwei Teilen. 1. Ralph sieht Ortcutt mit braunem Hut 2. Ralph sieht Ortcutt am Strand. II 162 Dann ist es ganz natürlich, dass Ralph in der einen Geschichte glaubt, dass Ortcutt ein Spion ist, und in der anderen Geschichte nicht. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass Ralph irgendwann zwischendurch seine Meinung geändert haben müsste. II 163 De re/Zuschreibung/Glauben de re/StalnakerVsQuine/StalnakerVsKaplan/Stalnaker: These: wir nehmen statt dessen Propositionen als Mengen von MöWe an. pragmatische Analyse/Pragmatik/Stalnaker: hat mit der semantischen gemein, dass bestimmte Überzeugungen zugeschrieben werden, aber – anders als die semantische – nimmt sie nicht eine bestimmte Art von Propositionen an, und verlangt auch keine verstärkte Bekanntschaftsrelation. D.h. die Individuen von denen etwas geglaubt wird, sind nicht Konstituenten der Proposition. Proposition: ihr Zweck ist es, eine Teilmenge der relevanten Kontextmenge herauszugreifen. Zuschreibung/de re/Stalnaker: (alle Autoren): die Weise, wie der Zuschreibende seine Zuschreibung formuliert ist unabhängig von der Weise, wie der Glaubende seine Überzeugung formulieren würde, bzw. die Weise, wie er über das Individuum denkt Pragmatischer Ansatz/Stalnaker: (…+…) |
Stalnaker I R. Stalnaker Ways a World may be Oxford New York 2003 |
| Notwendigkeit a posteriori | Physikalismus Vs Reduktionismus | Schwarz I 156 Physikalismus/VsReduktionismus/VsLewis. andere Autoren: der Physikalismus ist gar nicht auf die a priori Ableitbarkeit der mentalen aus den physikalischen Wahrheiten festgelegt, nur auf Supervenienz mentaler auf physikalischen Tatsachen. Das muss aber nicht a priori sein. Es kann A posteriori Notwendigkeit sein. Wie Bsp die Beziehung zwischen H2O-Wahrheiten und Wasser Wahrheiten. (Das ist der nicht-reduktive Physikalismus). LewisVs: das ist ein Missverständnis über a posteriori Notwendigkeit: Bsp Angenommen, „Wasser ist H2O“ ist a posteriori notwendig.: dann liegt das nicht daran, dass hier eine modale Tatsache besteht, eine Notwendigkeit, die wir nur a posteriori entdecken können, sondern vielmehr daran, dass die Bedeutung gewisser Wörter von kontingenten, empirischen Faktoren abhängt: nach unseren Konventionen greift „Wasser“ in allen möglichen Welten denjenigen Stoff heraus, der bei uns Seen und Bäche füllt. „Wasser ist H2O“ ist a posteriori, weil man erst einmal herausfinden muss, dass der Stoff, der bei uns Bäche und Seen füllt, H2O ist. Das ist eine kontingente Tatsache die gewöhnlich chemische Untersuchung erfordert, keine Ausflüge in den modalen Raum. Die H2O-Wahrheiten implizieren deshalb a priori die Wasser Wahrheiten. Wenn Schmerz a posteriori identisch ist mit einem physikalischen Zustand, dann muss auch das daran liegen, dass der Bezug von „Schmerz“ von kontingenten Tatsachen abhängt, davon, was für ein Zustand bei uns die und die Rolle spielt ((s) nicht, was für eine Sprachkonvention wir haben). (vgl. 1994b(1),296f). 1. David Lewis [1994b]: “Reduction of Mind”. In Samuel Guttenplan (Hg.), A Companion to the Philosophy of Mind, Oxford: Blackwell, 412–431, und in [Lewis 1999a] |
Schw I W. Schwarz David Lewis Bielefeld 2005 |
| Notwendigkeit a posteriori | Lewis Vs Stalnaker, R. | Read III 101/102 Stalnaker setzt die Wahrscheinlichkeit der Bedingungssätze mit der bedingten Wahrscheinlichkeit gleich. LewisVsStalnaker: Es gibt keine Aussage, deren Wahrscheinlichkeit durch die bedingte Wahrscheinlichkeit gemessen wird! (+ III 102) Nach Lewis ergibt sich, dass auf Grund von Stalnakers Annahme die Wahrscheinlichkeiten beim Kartenziehen unabhängig sind. Das ist aber offensichtlich falsch (im Gegensatz zum Würfeln). Also kann die Wahrscheinlichkeit des Bedingungssatzes nicht durch die bedingte Wahrscheinlichkeit gemessen werden. Read III 108 Bsp von Lewis: Wenn Bizet und Verdi Landsleute wären, wäre Bizet Italiener und Wenn Bizet und Verdi Landsleute wären, wäre Bizet nicht Italiener. Stalnaker: Die eine oder die andere muss wahr sein. Lewis: Beide sind falsch. (Weil nur konjunktivische Bedingungssätze nicht wahrheitsfunktional sind). Die indikativischen Stücke wären im Munde derjenigen, denen ihre Nationalität unbekannt ist, ganz akzeptabel. --- IV 149 Handlung/Rationalität/Stalnaker: Propositionen sind hier die geeigneten Objekte von Einstellungen. LewisVsStalnaker: Es stellt sich heraus, dass er eigentlich eine Theorie der Einstellungen de se braucht. Stalnaker: Der rational Handelnde ist jemand, der verschiedene mögliche rationale Zukünfte annimmt. Die Funktion des Wunschs ist einfach, diese verschiedenen Ereignisverläufe in die gewünschten und die abgelehnten zu unterteilen. Oder eine Ordnung oder ein Maß für alternative Möglichkeiten zu liefern in Bezug auf Wünschbarkeit. Glauben/Stalnaker: Seine Funktion ist es einfach, zu bestimmen, welchen die relevanten alternativen Situationen sein können, oder sie in Bezug auf ihre Wahrscheinlichkeit unter verschiedenen Bedingungen zu ordnen. Einstellungsobjekte/Glaubensobjekte/Stalnaker: Einstellungsobjekte und Glaubensobjekte sind identisch dann und nur dann, wenn sie funktional äquivalent sind, und das sind sie nur dann, wenn sie sich in keiner alternativ möglichen Situation unterscheiden. Lewis: Wenn diese alternativen Situationen immer alternative mögliche Welten (MöWe) sind, wie Stalnaker annimmt, dann ist das in der Tat ein Argument für Propositionen. ((s) Unterscheidung Situation/MöWe). Situation/MöWe/Möglichkeit/LewisVsStalnaker: Ich denke, es kann auch innerhalb einer einzelnen möglichen Welt Alternativen geben! Bsp Lingens weiß mittlerweile fast genug, um sich selbst zu identifizieren. Er hat seine Möglichkeiten auf zwei reduziert: a) Er ist im 6. Stock der Stanford Bücherei, dann muss er treppab gehen. Oder: b) Er ist im Untergeschoß der Bücherei des Widener College und muss treppauf gehen. Die Bücher sagen ihm, dass es genau einen Menschen mit Gedächtnisverlust an jedem dieser Orte gibt. Und er hat herausgefunden, dass er einer der beiden sein muss. Seine Überlegung liefert 8 Möglichkeiten: Die acht Fälle verteilen sich nur über vier Arten von Welten! Z.B. 1 und 3 gehören nicht zu verschiedenen Welten sondern sind 3000 Meilen entfernt in derselben Welt. Um diese zu unterscheiden braucht man wieder Eigenschaften. ((s) Die Propositionen gelten für beide Gedächtniskünstler gleichermaßen.) --- V 145 Konditionale/Wahrscheinlichkeit/Stalnaker: (1968)(1) Schreibweise: ">" (spitz, nicht Hufeisen!) Def Stalnaker Konditional: Ein Konditional A > C ist wahr gdw. die geringstmögliche Änderung, die A wahr macht, auch C wahr macht (Revision). Stalnaker: vermutet, dass damit P(A >C) und P(C I A) angeglichen werden, wenn A positiv ist. Die Sätze, die wie auch immer unter Stalnaker Bedingungen wahr sind, sind dann genau die, die positive Wahrscheinlichkeit haben unter seiner Hypothese über Wahrscheinlichkeit von Konditionalen. LewisVsStalnaker: Das gilt wohl meistens, aber nicht in gewissen modalen Kontexten, wo verschiedene Interpretationen einer Sprache die gleichen Sätze verschieden bewerten. V 148 Konditional/Stalnaker: Um zu entscheiden, ob man ein Konditional glauben soll: 1. Füge das Antezedens zur Menge deiner Glaubenseinstellungen hinzu, 2. Mache die nötigen Korrekturen für die Konsistenz 3. Entscheide, ob das Konsequens wahr ist. Lewis: Das ist richtig für ein Stalnaker-Konditional, wenn die vorgetäuschte Revision durch Abbildung erfolgt. V 148/149 LewisVsStalnaker: Die Passage suggeriert, dass man die Art Revision vortäuschen soll, die stattfindet, wenn das Antezedens wirklich zu den Glaubenseinstellungen hinzugefügt würde. Aber das ist falsch: Dann brauchte man Konditionalisierung. --- Schwarz I 60 Gegenstück/GS/Gegenstücktheorie/GT/Gegenstückrelation/GR/StalnakerVsLewis: Wenn man ohnehin fast beliebige Relationen als Gegenstückrelation zulässt, könnte man auch nicht qualitative Beziehungen verwenden. (Stalnaker 1987a)(2): Dann kann man Gegenstücke mit dem Haecceitismus versöhnen: Wenn man sich daran stößt, dass bei Lewis (x)(y)(x = y > N(x = y) falsch ist (Lewis pro kontingente Identität, s.o.), kann man auch festlegen, dass ein Ding stets nur ein Gegenstück pro Welt hat. Stalnaker/Schwarz: Das geht nicht mit qualitativen Gegenstückrelationen, da immer denkbar ist, dass mehrere Dinge – Bsp in einer völlig symmetrischen Welt – einem dritten Ding in einer anderen Welten genau gleich ähnlich sind. LewisVsStalnaker: VsNicht-qualitative Gegenstückrelation: Alle Wahrheiten einschließlich modaler Wahrheiten sollen darauf beruhen, was für Dinge es gibt (in der wirklichen Welt und möglichen Welten) und welche (qualitativen) Eigenschaften sie haben (“Mosaik“: > Humesche Welt). Schwarz I 62 Mathematik/Wahrmachen/Tatsache/Lewis/Schwarz: Wie bei möglichen Welten gibt es keine eigentliche Information: Bsp dass 34 die Wurzel von 1156 ist, sagt uns nichts über die Welt. ((s) Dass es in jeder Welt gilt. Regeln sind keine Wahrmacher). Schwarz: Bsp Dass es niemand gibt, der die rasiert, die sich nicht selbst rasieren, ist analog keine Information über die Welt.((s) Also nicht, dass die Welt qualitativ so aufgebaut ist). Schwarz: Vielleicht lernen wir hier eher etwas über Sätze. Es ist aber eine kontingente Wahrheit (!), dass Sätze wie Bsp „Es gibt jemand, der die rasiert, die sich nicht selbst rasieren“ inkonsistent ist. Lösung/Schwarz: Der Satz hätte etwas anderes bedeuten und damit konsistent sein können. Schwarz I 63 Scheinbar analytische Wahrheit/Lewis/Schwarz: Bsp Was erfahren wir, wenn wir erfahren, dass Ophtalmologen Augenärzte sind? Dass Augenärzte Augenärzte sind, wussten wir schon vorher. Wir haben eine kontingente semantische Tatsache erfahren. Modallogik/Modalität/modales Wissen/Stalnaker/Schwarz: These: Modales Wissen könnte immer als semantisches Wissen verstanden werden. Bsp Wenn wir fragen, ob Katzen notwendig Tiere sind, fragen wir, wie die Ausdrücke „Katze“ und „Tier“ zu gebrauchen sind (Stalnaker 1991(3), 1996(4), Lewis 1986e(5):36). Wissen/SchwarzVsStalnaker: Das reicht nicht, um kontingente Information zu erwerben, muss man immer die Welt untersuchen (kontingent/Schwarz: empirisches, nicht-semantisches Wissen). Modale Wahrheit/Schwarz: Der Witz an logischen, mathematischen und modalen Wahrheiten ist gerade, dass sie ohne Kontakt mit der Welt gewusst werden können. Hier erwerben wir keine Information. ((s) >Wahr machen: Keine empirische Tatsache „in der Welt“ macht, dass 2+2 = 4 ist. Siehe auch Nonfaktualismus). Schwarz I 207 „Sekundäre Wahrheitsbedingungen“/WB/semantischer Wert/Lewis/Schwarz: Zur Verwirrung trägt bei, dass die einfachen (s.o., kontextabhängige, ((s) „indexikalische) und variablen Funktionen von Welten auf Wahrheitswerte (WW) oft nicht nur als „semantische Werte“ sondern auch als Wahrheitsbedingungen bezeichnet werden. Wichtig: Diese Wahrheitsbedingungen (WB) müssen von den normalen Wahrheitsbedingungen unterschieden werden. Lewis: verwendet Wahrheitsbedingungen mal so mal so (1986e(5), 42-48: für primäre, 1969(6), Kap V: für sekundäre). Def primäre Wahrheitsbedingung/Schwarz: Primäre Wahrheitsbedingungen sind die Bedingungen, unter denen der Satz gemäß den Konventionen der jeweiligen Sprachgemeinschaft geäußert werden sollte. Wahrheitsbedingungen/Lewis/Schwarz: Wahrheitsbedingungen sind das Bindeglied zwischen Sprachgebrauch und formaler Semantik ihre Bestimmung ist der Zweck der Grammatik. Anmerkung: Def Diagonalisierung/Stalnaker/Lewis/Schwarz: Die primären Wahrheitsbedingungen erhält man durch Diagonalisierung, d.h. indem man als Welt-Parameter die Welt der jeweiligen Situation einsetzt (entsprechend als Zeit-Parameter den Zeitpunkt der Situation usw.). Def „diagonale Proposition“/Terminologie/Lewis: (nach Stalnaker, 1978(7)): Diagonale Propositionen sind primäre Wahrheitsbedingungen. Def horizontale Proposition/Lewis: Horizontale Propositionen sind sekundäre Wahrheitsbedingungen (1980a(8),38, 1994b(9),296f). Neuere Terminologie: Def A Intension/primäre Intension/1 Intension/Terminologie/Schwarz: für primäre Wahrheitsbedingungen Def C Intension/sekundäre Intension/2 Intension/Terminologie/Schwarz: für sekundäre Wahrheitsbedingungen. Def A Proposition/1-Proposition/C Proposition/2-Propsition/Terminologie/Schwarz: entsprechend (Jackson 1998a(10),2004(11), Lewis 2002b(12),Chalmers 1996b(13), 56, 65). Def meaning1/Terminologie/Lewis/Schwarz: (1975(14),173): sekundäre Wahrheitsbedingungen. Def meaning2/Lewis/Schwarz: ist eine komplexe Funktion von Situationen und Welten auf Wahrheitswerte, „zweidimensionale Intension“. Schwarz: Problem: Damit sind ganz verschiedene Dinge gemeint: Primäre Wahrheitsbedingungen/LewisVsStalnaker: Bei Lewis sind diese nicht über metasprachliche Diagonalisierung bestimmt wie Stalnakers diagonale Propositionen. Auch nicht über A priori Implikation wie bei Chalmers' primären Propositionen. Schwarz I 227 a posteriori Notwendigkeit/Metaphysik/Lewis/Schwarz: Normale Fälle sind keine Fälle von starker Notwendigkeit. Man kann herausfinden Bsp dass Blair Premier ist oder Bsp Abendstern mit Morgenstern korrespondiert. LewisVsInwagen/LewisVsStalnaker: Andere Fälle (die sich empirisch nicht herausfinden lassen) gibt es nicht. LewisVsStarke Notwendigkeit: Starke Notwendigkeit hat in seiner Modallogik keinen Platz. >LewisVsTeleskoptheorie: Welten sind nicht wie ferne Planeten, bei denen man herausfinden kann, welche es wohl gibt. 1. Robert C. Stalnaker [1968]: “A Theory of Conditionals”. In: Nicholas Rescher (Hg.), Studies in Logical Theory, Oxford: Blackwell, 98–112. 2.Robert C. Stalnaker [1987a]: “Counterparts and Identity”. Midwest Studies in Philosophy, 11: 121–140, In [Stalnaker 2003]. 3. Robert C. Stalnaker [1991]: “The Problem of Logical Omniscience I”. Synthese, 89. In [Stalnaker 1999a]. 4. Robert C. Stalnaker — [1996]: “On What Possible Worlds Could Not Be”. In: Adam Morton und Stephen P. Stich (Hg.), Benacerraf and his Critics, Cambridge (Mass.): Blackwell. In [Stalnaker 2003]. 5. David Lewis [1986e]: On the Plurality of Worlds. Malden (Mass.): Blackwell. 6. David Lewis[1969a]: Convention: A Philosophical Study. Cambridge (Mass.): Harvard University Press. 7. Robert C. Stalnaker [1978]: “Assertion”. In P. Cole (Hg.), Syntax and Semantics, Bd. 9, New York: Academic Press, 315–332, und in [Stalnaker 1999a]. 8. David Lewis [1980a]: “Index, Context, and Content”. In S. Kanger und S. ¨Ohmann (Hg.), Philosophy and Grammar, Dordrecht: Reidel, und in [Lewis 1998a]. 9. David Lewis [1994b]: “Reduction of Mind”. In Samuel Guttenplan (Hg.), A Companion to the Philosophy of Mind, Oxford: Blackwell, 412–431, und in [Lewis 1999a]. 10. Frank Jackson [1998a]: From Metaphysics to Ethics: A Defence of Conceptual Analysis. Oxford: Clarendon Press. 11. Frank Jackson [2004]: “Why We Need A-Intensions”. Philosophical Studies, 118: 257–277. 12. David Lewis [2002b]: “Tharp’s Third Theorem”. Analysis, 62: 95–97. 13. David Chalmers [1996b]: The Conscious Mind. New York: Oxford University Press. 14. David Lewis [1975]: “Languages and Language”. In [Gunderson 1975], 3–35. Und in [Lewis 1983d]. |
Lewis I David K. Lewis Die Identität von Körper und Geist Frankfurt 1989 Lewis I (a) David K. Lewis An Argument for the Identity Theory, in: Journal of Philosophy 63 (1966) In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis I (b) David K. Lewis Psychophysical and Theoretical Identifications, in: Australasian Journal of Philosophy 50 (1972) In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis I (c) David K. Lewis Mad Pain and Martian Pain, Readings in Philosophy of Psychology, Vol. 1, Ned Block (ed.) Harvard University Press, 1980 In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis II David K. Lewis "Languages and Language", in: K. Gunderson (Ed.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol. VII, Language, Mind, and Knowledge, Minneapolis 1975, pp. 3-35 In Handlung, Kommunikation, Bedeutung, Georg Meggle Frankfurt/M. 1979 Lewis IV David K. Lewis Philosophical Papers Bd I New York Oxford 1983 Lewis V David K. Lewis Philosophical Papers Bd II New York Oxford 1986 Lewis VI David K. Lewis Konventionen Berlin 1975 LewisCl Clarence Irving Lewis Collected Papers of Clarence Irving Lewis Stanford 1970 LewisCl I Clarence Irving Lewis Mind and the World Order: Outline of a Theory of Knowledge (Dover Books on Western Philosophy) 1991 Re III St. Read Philosophie der Logik Hamburg 1997 Schw I W. Schwarz David Lewis Bielefeld 2005 |
| Notwendigkeit a posteriori | Lewis Vs Unmögliche Welt | IV 21 Unmögliche Welt/VsUnmögliche Welt/VsUnMöWe/UnMöWe/VsLewis: Selbstkritik: "Wenn irgendwelche unmöglichen Welten vorstellbar sind, sollten wir sie als Welten zählen". Das hatte einen zu hohen Preis. Es gibt überhaupt keine unmöglichen Welten (UnMöWe), egal was für Vorstellungskünste am Werk sind. Angenommen, es gäbe UnMöWe: Wir müssten sehr sorgfältig sein, die unmöglichen Dinge in ihr zu beschreiben. Es kann: 1. konsistente Wahrheiten über solche extraordinären Gegenstände geben, 2. falsche Kontradiktionen über sie geben. Kontradiktion/Lewis: Eine Kontradiktion ist keine Wahrheit über irgend etwas weder existierend noch nicht existierend oder wie exotisch auch immer. Bsp Wir müssten unterscheiden können, zwischen: a) der unheimlichen Wahrheit über eine unmögliche Welt, in der Schweine fliegen können und gleichzeitig nicht fliegen können von b) der kontradiktorischen Falschheit, dass in dieser Welt Schweine fliegen können, obwohl es nicht so ist, dass in dieser Welt Schweine fliegen können. Das ist Unsinn! Eine solche Unterscheidung kann nicht getroffen werden. Ich weiß, dass es formale Mittel gibt, die angebliche Unterscheidung aufrechtzuerhalten. Es würde schon ausreichen, meinen eigenen Weg der Unterscheidung zwischen: 1. der Wahrheit über inkonsistenten Inhalt einer unmöglichen Geschichte und 2. kontradiktorischer Falschheit über diese Geschichte zu imitieren (s.u. "Wahrheit in der Fiktion"). Aber es bringt nichts, eine Unterscheidung zu verfolgen, die nicht existiert! Wenn Welten Geschichten wären, oder Modelle oder Repräsentationen dann könnte es sehr wohl unmögliche geben. Unmögliche Repräsentationen würden vorgeben, Welten zu repräsentieren, könnten es aber nicht. Wir könnten auch sehr gut unterscheiden zwischen einer Wahrheit über den Inhalt einer unmöglichen Repräsentation und einer kontradiktorischen Falschheit über sie. Aber Welten sind keine Repräsentationen, wie diese Welt bezeugt. --- Schwarz I 66 Unmögliche Welt/UnMöWe/Schwarz: Alternative zum Modalen Realismus: Man braucht Modalität, um MöWe von UnMöWe abzugrenzen: Bsp Eine Satzmenge kann ohne weiteres sowohl Bsp „es gibt Drachen“ als auch „es gibt keine Drachen“ enthalten. Schwarz I 67 Oder Bsp „Der Abendstern ist nicht der Morgenstern“. Lewis: Bei ihm gibt es keine UnMöWe. Weil es nicht zugleich sowohl Drachen als auch nicht Drachen geben kann (1983d(1): 21). ((s) >Existenz/“es gibt“: das ist eine Verschärfung der Unterscheidung von Existenz/“ Bestehen“ usw.: schwächere Form: „Es gibt Möglichkeiten“, stärkere: „Es gibt etwas Unmögliches“). UnMöWe/Lycan: (1991b(2), 224f): Eine UnMöWe könnte folgendermaßen gebraucht werden: Bsp wer erfährt, dass der Morgenstern identisch mit dem Abendstern ist, der kann Alternativen ausschließen. Pointe: Die ausgeschlossenen Alternativen sind keine Weisen wie die Dinge sein könnten. ((s) Das setzt voraus, dass jede Identität notwendig ist). Manche Autoren: nennen das „epistemisch oder begrifflich mögliche, aber metaphysisch unmögliche Welten“. LewisVsUnMöWe: Die Alternativen sind nicht unmöglich. Wir erfahren ja hier nicht, dass die Venus mit der Venus identisch ist, sondern eine Information über eine kontingente semantische Tatsache. ((s) Benennung). Das ist nicht Selbstidentität. Was man ausschließt, sind echte Möglichkeiten, und damit wird echte Information (Wissen) erworben. UnMöWe/Schwarz: UnMöWe werden also nicht für a posteriori Notwendigkeit gebraucht, aber sie helfen auch nicht bei a priori Notwendigkeit (wo scheinbare Information übermittelt wird). 1. David Lewis [1983d]: Philosophical Papers I. New York, Oxford: Oxford University Press. 2. William G. Lycan [1991b]: “Two – No, Three – Concepts of PossibleWorlds”. Proceedings of the Aristotelian Society, 91: 215–227. |
Lewis I David K. Lewis Die Identität von Körper und Geist Frankfurt 1989 Lewis I (a) David K. Lewis An Argument for the Identity Theory, in: Journal of Philosophy 63 (1966) In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis I (b) David K. Lewis Psychophysical and Theoretical Identifications, in: Australasian Journal of Philosophy 50 (1972) In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis I (c) David K. Lewis Mad Pain and Martian Pain, Readings in Philosophy of Psychology, Vol. 1, Ned Block (ed.) Harvard University Press, 1980 In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis II David K. Lewis "Languages and Language", in: K. Gunderson (Ed.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol. VII, Language, Mind, and Knowledge, Minneapolis 1975, pp. 3-35 In Handlung, Kommunikation, Bedeutung, Georg Meggle Frankfurt/M. 1979 Lewis IV David K. Lewis Philosophical Papers Bd I New York Oxford 1983 Lewis V David K. Lewis Philosophical Papers Bd II New York Oxford 1986 Lewis VI David K. Lewis Konventionen Berlin 1975 LewisCl Clarence Irving Lewis Collected Papers of Clarence Irving Lewis Stanford 1970 LewisCl I Clarence Irving Lewis Mind and the World Order: Outline of a Theory of Knowledge (Dover Books on Western Philosophy) 1991 Schw I W. Schwarz David Lewis Bielefeld 2005 |
Der gesuchte Begriff oder Autor findet sich in folgenden 3 Thesen von Autoren des zentralen Fachgebiets.
| Begriff/ Autor/Ismus |
Autor |
Eintrag |
Literatur |
|---|---|---|---|
| Kripke | Chalmers, D. | Stalnaker I 201 Kripke/Stalnaker: es bleibt kontrovers, was es eigentlich sei, das Kripke gezeigt hat. Kripke/Alan Sidelle/Jackson/Chalmers/Stalnaker: (Sidelle 1989, Jackson 1998, Chalmers 1996) Kripkes Thesen können damit in Einklang gebracht werden, I 202 daß alle Notwendigkeit ihre Wurzel in der Sprache und unseren Ideen hat. Allerdings in komplexerer Weise als der Empirismus annahm. Dann gibt es keine irreduzible Notwendigkeit a posteriori. notwendig a posteriori: ist danach aufteilbar in notwendige Wahrheit die a priori wissbar ist durch begriffliche Analyse, und einen Teil, der nur a posteriori wissbar ist, aber dieser ist kontingent. Das zeigen Chalmers und Jackson mit zwei-dimensionaler Semantik. |
Stalnaker I R. Stalnaker Ways a World may be Oxford New York 2003 |
| Kripke | Jackson, F. | Staln I 201 Kripke/Stalnaker: es bleibt kontrovers, was es eigentlich sei, das Kripke gezeigt hat. Kripke/Alan Sidelle/Jackson/Chalmers/Stalnaker: (Sidelle 1989, Jackson 1998, Chalmers 1996) These Kripkes Thesen können damit in Einklang gebracht werden, I 202 daß alle Notwendigkeit ihre Wurzel in der Sprache und unseren Ideen hat. Allerdings in komplexerer Weise als der Empirismus annahm. Dann gibt es keine irreduzible Notwendigkeit a posteriori. notwendig a posteriori: ist danach aufteilbar in notwendige Wahrheit die a priori wißbar ist durch begriffliche Analyse, und einen Teil, der nur a posteriori wißbar ist, aber dieser ist kontingent. Das zeigen Chalmers und Jackson mit zwei-dimensionaler Semantik. |
|
| Zweidim. Semant. | Stalnaker, R. | I 201/202 zwei-dimensionale Semantik/Stalnaker VsJackson/StalnakerVsChalmers: These ich denke, das zeigt etwas über die Natur mentaler Repräsentation und nicht nur über das kontingente Funktionieren von Sprachen. I 204 zwei-dimensionaler Rahmen/Stalnaker: ich werde die zwei Arten, ihn zu interpretieren aufzeigen a) semantisch b) metasemantisch. These mit dieser Unterscheidung möchte ich Notwendigkeit a posteriori reduzieren wie es Jackson und Chalmers getan haben. Damit kann das Problem der Intentionalität gelöst werden. |
|