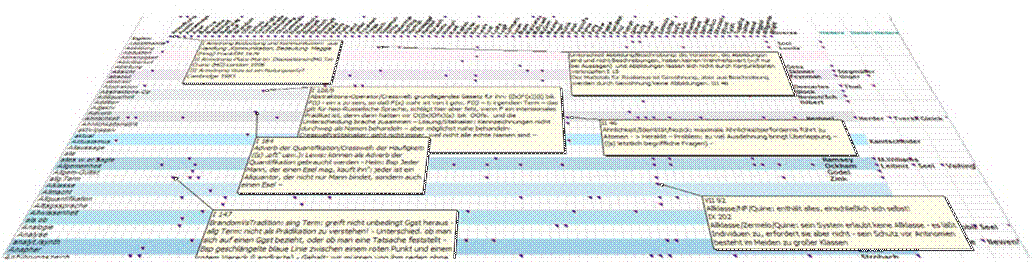Finden Sie Gegenargumente, in dem Sie NameVs…. oder….VsName eingeben.
| Begriff/ Autor/Ismus |
Autor Vs Autor |
Eintrag |
Literatur |
|---|---|---|---|
| Performanz Sprache | Harman Vs Chomsky, N. | I 306 Kompetenz/Performanz/HarmanVsChomsky: Kompetenz als "Wissen daß die Sprache durch Regeln der Grammatik beschrieben wird". Und daß "Grammatik diese Kompetenz spezifiziert". ChomskyVsHarman: das habe ich nicht nur nie behauptet, sondern auch mehrfach öffentlich zurückgewiesen. Es wäre auch absurd, wenn der Sprecher die Regeln explizit kennen müßte. Wissen/Sprache/Harman: a) Wissen daß, b) Wissen wie. Da Sprache offensichtlich kein "Wissen, daß" ist, muß es "Wissen, wie" sein. Der Sprecher weiß, "wie er andere Sprecher zu verstehen hat". Analog zur Fähigkeit des Fahrradfahrers. I 307 ChomskyVsHarman: er gebraucht "Kompetenz" ganz anders als ich. Ich sehe keine Beziehung zur "Fähigkeit des Fahrradfahrers", keine "Menge von Gewohnheiten" oder etwas derartiges. I 308 HarmanVsChomsky: das internalisierte System (das die Auswahl der Grammatiken beschränkt) muß in einer grundlegenderen Sprache" dargestellt werden, und das Kind muß letztere bereits verstanden haben muß, ehe es diesen Schematismus anwenden kann. a) das führt zu einem Zirkel: würde man sagen, daß das Kind die "grundlegendere Sprache" "direkt" , ohne sie gelernt zu haben, beherrscht, warum sagt man dann nicht auch, daß es die eigentliche Sprache "direkt" , ohne sie zu lernen, beherrscht. Oder: b) Regreß: sagt man dagegen, daß es die grundlegendere Sprache erst lernen muß, dann stellt sich die Frage, wie diese grundlegende Sprache selbst gelernt wird, ChomskyVsHarman: selbst wenn man annimmt, daß der Schematismus an einer "angeborenen Sprache" dargestellt sein muß, folgt nicht das, was Harman sieht: Das Kind muß vielleicht die "grundlegendere Sprache" beherrschen, aber es muß sie nicht "sprechen und verstehen". Wir müssen nur annehmen, daß es davon Gebrauch machen kann. ad a): die Annahme ist falsch, daß das Kind seine MutterSprache beherrscht, ohne sie zu lernen. Es wird nicht mit perfekten Deutschkenntnissen geboren. Andererseits spricht nichts gegen die Annahme, daß es mit perfekten Kenntnissen einer universalen Grammatik geboren wird. HarmanVsChomsky: in einem Modell kann erst dann aus gegebenen Daten auf eine Grammatik geschlossen werden, wenn in dem Modell bereits detaillierte Informationen über eine Theorie der Performanz enthalten sind. Chomsky: interessant, aber nicht zwingend. I 310 Empirie/Theorie/HarmanVsChomsky: nennt Chomskys Strategie "erfinderischen Empirismus", eine Doktrin, die "Induktionsprinzipien" verwendet. Solcher "erfindungsreichen Empirismus" sei sicher nicht zu widerlegen, "ganz gleich, wie die sprachlichen Daten aussehen". ChomskyVsHarman: Empirismus ist nicht so wichtig. Mich interessiert die Frage, ob es "Ideen und Prinzipien verschiedener Art" gibt, die die "Form der erworbenen Kenntnis auf weitgehend festgelegte und hochorganisierte Weise determinieren" (Rationalistische Variante) oder ob andererseits "die Struktur des Aneignungsmechanismus auf einfache und periphere Verarbeitungsmechanismen beschränkt ist..." (empiristische Variante). Es ist historisch gerechtfertigt und heuristisch sinnvoll, das auseinanderzuhalten. |
Harman I G. Harman Moral Relativism and Moral Objectivity 1995 Harman II Gilbert Harman "Metaphysical Realism and Moral Relativism: Reflections on Hilary Putnam’s Reason, Truth and History" The Journal of Philosophy, 79 (1982) pp. 568-75 In Theories of Truth, Paul Horwich Aldershot 1994 |
| Performanz Sprache | Putnam Vs Chomsky, N. | Chomsky I 293 PutnamVsChomsky: Putnam nimmt für die Phonetik in der universalen Grammatik an, dass sie lediglich eine einzige Liste von Lauten hat. Das erfordere keine ausgefeilte Erklärungshypothese. Nur "Gedächtnisspanne und Erinnerungsvermögen". "Kein aufrechter Behaviorist würde leugnen, dass dies angeborene Eigenschaften sind". ChomskyVsPutnam: es sind aber sehr starke empirische Hypothesen über die Auswahl der universellen distinktiven Merkmale aufgestellt worden, von denen offenbar keine auf der Grundlage von Beschränkungen des Gedächtnisses erklärt werden kann. Chomsky I 298 PutnamVsChomsky: These statt eines angeborenen Schematismus könnte man "generelle Mehrzweck Strategien" annehmen. Diese angeborene Basis müsste für den Erwerb jedweden Wissens die gleiche sein, sodass nichts Besonderes am Spracherwerb ist. Chomsky I 299 ChomskyVsPutnam: damit ist er nicht mehr zur Annahme von etwas Angeborenem berechtigt. Außerdem verschiebt es das Problem nur. PutnamVsChomsky: die in der universalen Grammatik vorgeschlagenen Bewertungsfunktionen "wird die Art von Fakten konstituiert, die die Lerntheorie zu erklären versucht, nicht aber die gesuchte Erklärung selbst". ChomskyVsPutnam: Bsp niemand würde sagen, daß die genetische Basis für die Entwicklung von Armen statt Flügeln "die Art von Tatsache ist, die die Lerntheorie zu erklären versucht". Vielmehr sind sie die Grundlage für eine Erklärung anderer Fakten des menschlichen Verhaltens. Ob die Bewertungsfunktion erlernt wird oder die Grundlage des Lernen ist, ist eine empirische Frage. PutnamVsChomsky: bestimmte Mehrdeutigkeiten können erst durch Routine entdeckt werden, daher ist ihre postulierte Erklärung durch Chomskys Grammatik nicht so beeindruckend. ChomskyVsPutnam: das mißversteht er, in Wirklichkeit bezieht sich das auf Kompetenz und nicht auf Performanz (tatsächliche Praxis). Was die Grammatik erklärt ist, warum Bsp in "die Kritik der Studenten" "Studenten" als Subjekt oder Objekt verstanden werden kann, während Bsp "Korn" in "das Wachsen des Korns" nur Subjekt sein kann. Die Frage der Routine spielt hier gar keine Rolle. Chomsky I 300 angeborene Ideen/ChomskyVsPutnam: die angeborene Repräsentation der universalen Grammatik löst das Problem des Lernens tatsächlich (zumindest zum Teil) wenn es wirklich stimmt, daß diese die Basis für den Spracherwerb darstellt, was sehr wohl der Fall sein kann! III 87 Putnam/Chomsky: Putnam schlägt vor: Korrektheit in der Linguistik ist, was sie gegenwärtig verfügbaren Daten über das Verhalten des Sprechers, unter einem gegenwärtigen Interesse am besten erklären. Was heute richtig ist, wird morgen falsch sein. PutnamVsChomsky: ich habe nie behauptet, was heute richtig ist, wird morgen falsch sein. Putnam: Chomskys verborgene Hauptthesen: 1. das es uns freisteht, unsere Interessen nach Belieben zu wählen, 2. dass Interessen ihrerseits keiner normativen Kritik unterliegen. Bsp der Herzanfall von Hans liegt in der Missachtung der ärztlichen Gebote. Andere Erklärung: hoher Blutdruck. Es kann sein, dass tatsächlich an einem Tag mehr das eine, am andern Tag mehr das andere Faktum im Interesse des Sprechers legt. III 88 PutnamVsChomsky: 1. unsere Interessen können wir uns nicht einfach aussuchen. 2. es kommt mitunter vor, dass die Relevanz eines bestimmten Interesses umstritten ist. Wie kommt es jedoch, dass einige Interessen vernünftiger sind als andere? Vernünftigkeit sei in verschiedenen Zusammenhängen von verschiedenen Bedingungen abhängig. Es gibt keine allgemeingültige Antwort. III 88/89 Die Behauptung, ein Begriff sei interessenrelativ, läuft nicht auf das Gleiche hinaus wie die These, alle Interessen seien in gleichem Maße vernünftig. |
Putnam I Hilary Putnam Von einem Realistischen Standpunkt In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Frankfurt 1993 Putnam I (a) Hilary Putnam Explanation and Reference, In: Glenn Pearce & Patrick Maynard (eds.), Conceptual Change. D. Reidel. pp. 196--214 (1973) In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (b) Hilary Putnam Language and Reality, in: Mind, Language and Reality: Philosophical Papers, Volume 2. Cambridge University Press. pp. 272-90 (1995 In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (c) Hilary Putnam What is Realism? in: Proceedings of the Aristotelian Society 76 (1975):pp. 177 - 194. In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (d) Hilary Putnam Models and Reality, Journal of Symbolic Logic 45 (3), 1980:pp. 464-482. In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (e) Hilary Putnam Reference and Truth In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (f) Hilary Putnam How to Be an Internal Realist and a Transcendental Idealist (at the Same Time) in: R. Haller/W. Grassl (eds): Sprache, Logik und Philosophie, Akten des 4. Internationalen Wittgenstein-Symposiums, 1979 In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (g) Hilary Putnam Why there isn’t a ready-made world, Synthese 51 (2):205--228 (1982) In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (h) Hilary Putnam Pourqui les Philosophes? in: A: Jacob (ed.) L’Encyclopédie PHilosophieque Universelle, Paris 1986 In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (i) Hilary Putnam Realism with a Human Face, Cambridge/MA 1990 In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (k) Hilary Putnam "Irrealism and Deconstruction", 6. Giford Lecture, St. Andrews 1990, in: H. Putnam, Renewing Philosophy (The Gifford Lectures), Cambridge/MA 1992, pp. 108-133 In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam II Hilary Putnam Repräsentation und Realität Frankfurt 1999 Putnam III Hilary Putnam Für eine Erneuerung der Philosophie Stuttgart 1997 Putnam IV Hilary Putnam "Minds and Machines", in: Sidney Hook (ed.) Dimensions of Mind, New York 1960, pp. 138-164 In Künstliche Intelligenz, Walther Ch. Zimmerli/Stefan Wolf Stuttgart 1994 Putnam V Hilary Putnam Vernunft, Wahrheit und Geschichte Frankfurt 1990 Putnam VI Hilary Putnam "Realism and Reason", Proceedings of the American Philosophical Association (1976) pp. 483-98 In Truth and Meaning, Paul Horwich Aldershot 1994 Putnam VII Hilary Putnam "A Defense of Internal Realism" in: James Conant (ed.)Realism with a Human Face, Cambridge/MA 1990 pp. 30-43 In Theories of Truth, Paul Horwich Aldershot 1994 SocPut I Robert D. Putnam Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community New York 2000 Chomsky I Noam Chomsky "Linguistics and Philosophy", in: Language and Philosophy, (Ed) Sidney Hook New York 1969 pp. 51-94 In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Chomsky II Noam Chomsky "Some empirical assumptions in modern philosophy of language" in: Philosophy, Science, and Method, Essays in Honor of E. Nagel (Eds. S. Morgenbesser, P. Suppes and M- White) New York 1969, pp. 260-285 In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Chomsky IV N. Chomsky Aspekte der Syntaxtheorie Frankfurt 1978 Chomsky V N. Chomsky Language and Mind Cambridge 2006 |
| Performanz Sprache | Searle Vs Chomsky, N. | SearleVsChomsky: Chomsky ging einen Schritt zu weit: er hätte leugnen sollen, dass das Sprachorgan überhaupt eine Struktur hat, die sich als Automat beschreiben lässt. So hat er sich der analytischen Technik ausgeliefert. Dennett I 555 Sprache/SearleVsChomsky: Man kann den Spracherwerb so erklären: es gibt tatsächlich eine angeborene Spracherwerbsvorrichtung. Es wird aber der Hardware-Erklärung nichts hinzugefügt, wenn man tief unbewußte universalgrammatische Regeln annimmt. Das steigert nicht den Vorhersagewert. Es gibt die nackten, blinden neurophysiologischen Vorgänge und es gibt Bewusstsein,. Darüber hinaus gibt es nichts. ((s) sonst Regress durch Zwischeninstanzen). Searle I 273 SearleVsChomsky: für die Universalgrammatik gibt es eine viel einfachere Hypothese: Es gibt tatsächlich eine Spracherwerbsvorrichtung. Sie bringt Einschränkungen mit sich, welche Sprachtypen für den Menschen erlernbar sind. Und es gibt eine funktionale Erklärungsebene, welche Sprachtypen das Kleinkind erlernen kann, wenn es diesen Mechanismus anwendet. Durch unbewusste Regeln wird der Erklärungswert keineswegs gesteigert. IV 9 SearleVsChomsky/SearleVsRyle: es gibt weder alternative Tiefenstrukturen noch bedarf es spezieller Konversationspotulate. IV 204 Sprechakttheorie/SearleVsChomsky: oft wird im Anschluss an Chomsky gesagt, die Sprache müsse endlich vielen Regeln gehorchen (für unendlich viele Formen). IV 205 Das ist irreführend, und war nachteilig für die Forschung. Besser ist dieses Bild: Zweck der Sprache ist die Kommunikation. Deren Einheit ist der illokutionäre Sprechakt. Es geht darum, wie wir von Lauten zu den Akten gelangen. VIII 411 Grammatik/Sprache/Chomsky/Searle: Chomskys Schüler, (von Searle "Jungtürken" genannt) verfolgen Chomskys Ansatz radikaler über Chomsky hinaus. (s.u.). Aspekte der Syntaxtheorie/Chomsky: (reifes Werk, 1965 (1)) ambitiösere Ziele als bisher: Erklärung aller sprachlichen Beziehungen zwischen dem Lautsystem und dem Bedeutungssystem. VIII 412 Dazu muss die Grammatik aus drei Teilen bestehen: 1. syntaktische Komponente, die die interne Struktur der unendlichen Anzahl von Sätzen beschreibt, (Herz der Grammatik) 2. phonologische Komponente: Lautstruktur. (rein interpretativ) 3. semantische Komponente. (rein interpretativ),. Auch der Strukturalismus verfügt über Phrasenstrukturregeln. VIII 414 Dabei wird nicht behauptet, dass ein Sprecher einen derartigen Prozess der Anwendung von Regeln (z.B. "Ersetze x durch y") tatsächlich bewusst oder unbewusst durchläuft. Das anzunehmen wäre eine Verwechslung von Kompetenz und Performanz. SearleVsChomsky: Hauptproblem: es ist noch nicht klar, wie die vom Grammatiker gelieferte Theorie der Konstruktion von Sätzen genau die Fähigkeit des Sprechers repräsentieren und in genau welchem Sinn von "kennen" der Sprecher die Regeln kennen soll. VIII 420 Sprache/Chomsky/Searle: Chomskys Auffassung der Sprache ist exzentrisch! Entgegen der common sense Auffassung diene sie nicht zur Kommunikation! Statt dessen nur allgemeine Funktion, die Gedanken des Menschen auszudrücken. VIII 421 Falls Sprache doch eine Funktion hat, so gibt es dennoch keinen signifikanten Zusammenhang mit ihrer Struktur! These: die syntaktischen Strukturen sind angeboren und besitzen keinen signifikanten Zusammenhang mit Kommunikation, obwohl man sie natürlich zur Kommunikation verwendet. Das Wesentliche an der Sprache ist ihre Struktur. Bsp Die "BienenSprache" ist überhaupt keine Sprache, da sie nicht die richtige Struktur besitzt. Pointe: wenn der Mensch eines Tages zu einer Kommunikation mit ganz anderen syntaktischen Formen käme, besäße er keine Sprache mehr, sondern irgendetwas anderes! Generative Semantik/"Jungtürken"VsChomsky: einer der entscheidenden Faktoren bei der Bildung syntaktischer Strukturen ist die Semantik. Selbst Begriffe wie "grammatisch korrekt" oder "wohlgeformter Satz" verlangen die Einführung semantischer Begriffe! Bsp "Er nannte ihn einen Republikaner und beleidigte ihn". ChomskyVsJungtürken: Scheinstreit, die Kritiker haben die Theorie lediglich in einer neuen Terminologie reformuliert. VIII 422 Jungtürken: Ross, Postal, Lakoff, McCawley, Fillmore. These: die Grammatik beginnt mit einer Beschreibung der Bedeutung eines Satzes. Searle: wenn die Generative Semantik recht hat und es keine syntaktischen Tiefenstrukturen gibt, wird die Linguistik erst recht interessant, wir können dann systematisch untersuchen, wie Form und Funktion zusammenhängen. (Chomsky: hier gibt es keinen Zusammenhang!). VIII 426 angeborene Ideen/Descartes/SearleVsChomsky: Descartes hat zwar die Idee eines Dreiecks oder der Vollkommenheit als angeboren angesehen, aber von Syntax natürlicher Sprache hat er nichts behauptet. Er scheint ganz im Gegenteil angenommen zu haben, dass Sprache willkürlich ist: er nahm an, dass wir unseren Ideen willkürlich Wörter beilegen! Begriffe sind für Descartes angeboren, Sprache nicht. Unbewusstes: ist bei Descartes nicht zugelassen! VIII 429 Bedeutungstheorie/BT/SearleVsChomsky/SearleVsQuine: die meisten Bedeutungstheorien begehen denselben Fehlschluss: Dilemma: a) entweder die Analyse der Bedeutung enthält selbst einige zentrale Elemente des zu analysierenden Begriffs, zirkulär. ((s) > McDowell/PeacockeVs: Verwechslung Erwähnung/Gebrauch; >Erwähnung, >Gebrauch). b) die Analyse führt den Gegenstand auf kleinere Elemente zurück, denen seine entscheidenden Merkmale abgehen, dann ist sie unbrauchbar, weil sie inadäquat ist! SearleVsChomsky: Chomskys generative Grammatik begeht denselben Fehlschluss: wie man von der syntaktischen Komponente der Grammatik erwartet, dass sie die syntaktische Kompetenz des Sprechers beschreibt. Die semantische Komponente besteht aus einer Menge von Regeln, die die Bedeutungen der Sätze bestimmen, und setzt dabei sicherlich richtig voraus, dass die Bedeutung eines Satzes von der Bedeutung seiner Elemente sowie von deren syntaktischer Kombination abhängt. VIII 432 Dasselbe Dilemma: a) Bei den verschiedenen Lesarten mehrdeutiger Sätze handelt es sich lediglich um Paraphrasen, dann ist die Analyse zirkulär. Bsp Eine Theorie, die die Kompetenz erklären will, darf nicht zwei Paraphrasen von "Ich ging zur Bank" anführen, weil die Fähigkeit, die Paraphrasen zu verstehen, genau die Kompetenz voraussetzt, die sie erklären will! Ich kann die generelle Kompetenz, Deutsch zu sprechen nicht dadurch erklären, dass ich einen deutschen Satz in einen anderen deutschen Satz übersetze! b) Die Lesarten bestehen nur aus Listen von Elementen, dann ist die Analyse inadäquat: sie kann nicht erklären, dass der Satz eine Behauptung ausdrückt. VIII 433 ad a) VsVs: es wird behauptet, dass die Paraphrasen lediglich illustrativen Zweck hätten und nicht wirklich Lesarten seien. SearleVs: doch was können die wirklichen Lesarten sein? Bsp Angenommen, wir könnten die Lesarten als Steinhaufen interpretieren: für einen sinnlosen Satz gar keine, für einen analytischen Satz wird die Anordnung im Prädikat Haufen in dem Subjekthaufen enthalten sein usw. Nichts in den formalen Eigenschaften der semantischen Komponente könnte uns davon abhalten, aber statt einer Erklärung der Beziehungen zwischen Laut und Bedeutung ieferte die Theorie eine nicht erklärte Beziehung zwischen Lauten und Steinen. VsVs: wir könnten die wirklichen Lesarten in einem zukünftigen universalen semantischen Alphabet ausgedrückt finden. Die Elemente stehen dann für die Bedeutungseinheiten in allen Sprachen. SearleVs: dasselbe Dilemma: a) Entweder ist das Alphabet eine Art neuer künstlicher Sprache und die Lesarten wiederum Paraphrasen, nur diesmal in Esperanto oder b) Die Lesarten in dem semantischen Alphabet sind lediglich eine Liste von Merkmalen der Sprache. Die Analyse ist inadäquat, weil sie einen Sprechakt durch eine Liste von Elementen ersetzt. VIII 434 SearleVsChomsky: der semantische Teil seiner Grammatik kann nicht erklären, was denn der Sprecher eigentlich erkennt, wenn er eine der semantischen Eigenschaften erkennt. Dilemma: entweder steriler Formalismus oder uninterpretierte Liste. Sprechakttheorie/SearleVsChomsky: Lösung: Sprechakte haben zwei Eigenschaften, deren Kombination uns aus dem Dilemma entlässt: sie sind regelgeleitet und intentional. Wer einen Satz wörtlich meint, äußert ihn in Übereinstimmung mit gewissen semantischen Regeln und mit der Intention, seien Äußerung gerade durch die Berufung auf diese Regeln zum Vollzug eines bestimmten Sprechakts zu machen. VIII 436 Bedeutung/Sprache/SearleVsChomsky: es gibt keine Möglichkeit, die Bedeutung eines Satzes ohne Berücksichtigung seiner kommunikativen Rolle zu erklären. VIII 437 Kompetenz/Performanz/SearleVsChomsky: seine Unterscheidung ist verfehlt: er nimmt anscheinend an, dass eine Theorie der Sprechakte eher eine Theorie der Performanz als eine der Kompetenz sein muss. Er sieht nicht, dass Kompetenz letztlich Performanz Kompetenz ist. ChomskyVsSprechakttheorie: Chomsky scheint hinter der Sprechakttheorie den Behaviorismus zu argwöhnen. 1. Noam Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge 1965 |
Searle I John R. Searle Die Wiederentdeckung des Geistes Frankfurt 1996 Searle II John R. Searle Intentionalität Frankfurt 1991 Searle III John R. Searle Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit Hamburg 1997 Searle IV John R. Searle Ausdruck und Bedeutung Frankfurt 1982 Searle V John R. Searle Sprechakte Frankfurt 1983 Searle VII John R. Searle Behauptungen und Abweichungen In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Searle VIII John R. Searle Chomskys Revolution in der Linguistik In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Searle IX John R. Searle "Animal Minds", in: Midwest Studies in Philosophy 19 (1994) pp. 206-219 In Der Geist der Tiere, D Perler/M. Wild Frankfurt/M. 2005 Dennett I D. Dennett Darwins gefährliches Erbe Hamburg 1997 Dennett II D. Dennett Spielarten des Geistes Gütersloh 1999 Dennett III Daniel Dennett "COG: Steps towards consciousness in robots" In Bewusstein, Thomas Metzinger Paderborn/München/Wien/Zürich 1996 Dennett IV Daniel Dennett "Animal Consciousness. What Matters and Why?", in: D. C. Dennett, Brainchildren. Essays on Designing Minds, Cambridge/MA 1998, pp. 337-350 In Der Geist der Tiere, D Perler/M. Wild Frankfurt/M. 2005 |
| Performanz Sprache | Cresswell Vs Lewis, David | I 23 Performanz/Kompetenz/semantische/Cresswell: welche Beziehungen gibt es zwischen beiden? Lewis: Konvention der Wahrhaftigkeit und des Vertauens: in L: These: darauf basiert der meiste Sprachgebrauch. I 24 Wir nehmen an, die Sprecher versuchen, wahre Sätze zu äußern und erwarten dasselbe von den anderen. Pointe/CresswellVsLewis: das kann nun so sein, scheint mir aber eher eine Frage der empirische Untersuchung als eine Definition, daß es so sein sollte, zu sein. Und zwar deshalb: I 33 Sprache /Bigelow/Cresswell: John Bigelow erzählt mir, These: daß eine der frühesten Funktionen der Sprache Geschichtenerzählen war. Dann geht es mehr um Vorstellungskraft als um alltägliche Kommunikation! ((s)VsCresswell: 1. woher weiß Bigelow das? 2. warum sollte man daraus so weitgehende Schlüsse ziehen?). CresswellVsLewis: selbst wenn sich herausstellen sollte, daß es eine logische Verbindung zwischen der Konvention und dem Sprachgebrauch gäbe, scheint es mir besser, das nicht von vornherein in eine Theorie der Semantik einzubauen. Jedenfalls brauchen wir keine Verbindung von Kompetenz und Performanz. II 142 Fiktion/Glauben de re/Lewis/Cresswell: (Lewis 1981, 288): Bsp in Frankreich glauben die Kinder, daß Papa Noel allen Kindern Geschenke bringt, in England Father Christmas nur den braven (, diese kommen dafür das doppelte, wie Pierre sich ausrechnet). de re/Fiktion/Lewis: das kann keine Einstellung de re sein, weil es diese res in beiden Fällen nicht gibt. Fiktion/CresswellVsLewis: auch hier kann man eine Referenz de re haben, auch wenn die Kausalverbindung nicht direkt ist. Lösung/Devitt: das Geschichtenerzählen. |
Cr I M. J. Cresswell Semantical Essays (Possible worlds and their rivals) Dordrecht Boston 1988 Cr II M. J. Cresswell Structured Meanings Cambridge Mass. 1984 |
| Performanz Sprache | Chomsky Vs Quine, W.V.O. | II 319 Sprache/Quine: Geflecht von Sätzen. Theorie/Sprache/ChomskyVsQuine: Quine selbst muß sogar voraussetzen, daß beide getrennt sind: er ist sicher nicht der Ansicht, daß zwei monolinguale Sprecher der selben Sprache keine Meinungsverschiedenheiten haben können! ((s) Wenn Sprache und Theorie identisch wären, könnte man sich nicht streiten, da selbst nach Quine die Theorien eine gewisse Einheitlichkeit haben müssen). Chomsky: sonst wäre nach Quine jeder Streit völlig irrational, wie zwischen zwei Sprechern verschiedener Sprachen. II 320 Def Sprache/Quine: "Komplex von vorliegenden Dispositionen zu verbalem Verhalten, in denen sich Sprecher derselben Sprache notgedrungen einander angeglichen haben". (W+O,27) Sprache/ChomskyVsQuine: dann müßte sich unsere Disposition zu einem bestimmten Verbalverhalten durch ein bestimmtes System erklären lassen. Das ist sicher nicht der Fall. II 321 Verstärkung/ChomskyVsQuine: sein Begriff der "Verstärkung" ist nahezu leer. Wenn zum Lernen Verstärkung benötigt wird, läuft das darauf hinaus, daß Lernen nicht ohne Daten vonstatten gehen kann. Das ist noch leerer als bei Skinner, der im Gegensatz zu Quine nicht einmal verlangt, daß verstärkende Reize einwirken. Hier genügt es, daß die Verstärkung bloß vorgestellt ist. II 324 Sprachlernen: behavioristisch/Quine: Konditionierung, Assoziation ChomskyVsQuine: zusätzlich Prinzipien, nur so unendlich viele Sätze erklärbar. Wahrscheinlichkeit/Sprache/ChomskyVsQuine: der Begriff der "Wahrscheinlichkeit eines Satzes" ist völlig nutzlos und leer: II 325 Übersetzungsunbestimmtheit, Unbestimmtheit: ChomskyVsQuine: Disposition entweder in Bezug auf Reiz, oder in Bezug auf Gesamtkorpus der Sprache: dann alle Sätze gleichwahrscheinlich (Bezugsklassen) II 326 logische Wahrheit/Quine: wird bei ihm von Konditionierungsmechanismen hergeleitet, die bestimmte Satzpaare miteinander assoziieren, II 327 so daß unsere Kenntnis der logischen Relationen als ein finites System verknüpfter Sätze repräsentierbar sein muß. ChomskyVsQuine: dabei bleibt unklar, wie wir logische von kausalen Relationen unterscheiden. Wahrheitsfunktionen/Quine: erlauben eine radikale Übersetzung ohne "nicht verifizierbare analytische Hypothesen" daher lassen sie sich aus dem empirischen Datenmaterial unmittelbar erlernen (W+O § 13) ChomskyVsQuine: seine Bereitschaft, diese Dinge innerhalb des Rahmens der radikalen Übersetzung anzusiedeln, zeigt möglicherweise, daß er bereit ist, Logik als eine angeborene erfahrungsunabhängige Basis für das Lernen anzusehen. Dann ist es jedoch willkürlich, gerade diesen Rahmen als angeboren zu akzeptieren, und nicht auch vieles andere, das man ebenfalls beschreiben oder sich vorstellen kann. II 328 ChomskyVsQuine: sein eng gefaßter Humescher Rahmen (Chomsky pro) mit der Sprache als endlichem (!?) Geflecht von Sätzen ist mit diversen Binsenwahrheiten unverträglich, die auch Quine sicherlich akzeptieren würde II 329 analytische Hypothese/Reizbedeutung/Quine: Reizbedeutung involviert im Gegensatz zur analytischen Hypothese lediglich "normale induktive Ungewissheit". Da die entsprechenden Sätze Wahrheitsfunktionen enthalten können, führen sie zur "normalen Induktion". Das ist noch keine "Theoriekonstruktion" wie bei den analytischen Hypothesen. ChomskyVsQuine: die Unterscheidung ist nicht klar, weil die normale Induktion auch innerhalb der radikalen Übersetzung vorkommt. II 330 ChomskyVsQuine: Vs "Eigenschaftsraum": nicht sicher ob die Begriffe der Sprache mit physikalischen Dimensionen erklärt werden können Aristoteles: eher mit Handlungen verknüpft. - VsQuine: nicht evident, daß Ähnlichkeiten in einem Raum lokalisierbar sind Prinzipien, nicht "gelernte Sätze" I 333 VsQuine: kann nicht von "Disposition zur Reaktion" abhängig sein, sonst wären Stimmungen, Augenverletzungen, Ernährungsstand usw. zu maßgeblich I 343 Sprache muß vielleicht gar nicht gelehrt werden. II 335 Synonymie/ChomskyVsQuine: (dieser hatte vorgeschlagen, daß Synonymie "grob gesprochen" in annähernder Gleichheit der Situationen, und annähernd gleicher Wirkung bestehe). Chomsky: es besteht nicht einmal annähernde Gleichheit in den Bedingungen, die mit Wahrscheinlichkeit synonyme Äußerungen hervorbringen. ChomskyVsQuine: Synonymie kann man also nicht mit Hilfe von Gebrauchsbedingungen (Behauptungsbedingungen) oder Wirkungen auf den Hörer charakterisieren. Es ist wesentlich, zwischen langue und parole, zwischen Kompetenz und Performanz zu unterscheiden. Es geht um sinnvolle Idealisierung, Quines Idealisierung ist sinnlos. II 337 Übersetzungsunbestimmtheit/ChomskyVsQuine: die These läuft in einem psychologischen Kontext auf eine unplausible und ziemlich gehaltlose empirische Behauptung hinaus, nämlich darüber, welche angeborenen Eigenschaften der Geist zu Spracherwerb beisteuert. In einem erkenntnistheoretischen Kontext ist Quines These lediglich eine Version der bekannten skeptischen Argumente, die genauso gut auf die Physik oder anderes angewendet werden können. II 337 Unterbestimmtheit/Unbestimmtheit/Theorie/ChomskyVsQuine: jede Hypothese geht über die Daten hinaus, sonst wäre sie uninteressant Quine V 32 Def Sprache/Quine: „Komplex von Dispositionen zu sprachlichem Verhalten“. ((s) das könnte man zirkulär nennen, weil „sprachlich“ vorkommt. Vs: dann soll damit ausgedrückt werden, dass es neben dem Verhalten eben nicht noch eine Sprache gibt.) Disposition/ChomskyVsQuine: so ein Komplex lässt sich vermutlich als eine Menge von Wahrscheinlichkeiten darstellen, unter bestimmten Umständen eine Äußerung zu machen. Vs: der Begriff der Wahrscheinlichkeit bringt gar nichts: die Wahrscheinlichkeit, mit der ich einen bestimmten englischen Satz äußere, ist gar nicht zu unterscheiden von der Wahrscheinlichkeit, mit der ich einen bestimmten japanischen Satz äußere. QuineVsChomsky: man vergesse nicht, dass Dispositionen ihre Bedingungen haben. V 33 Diese finden wir durch das Verfahren von Frage und Zustimmung. Quine XI 115 Sprache/Theorie/ChomskyVsQuine/Lauener: die Sprache einer Person und ihre Theorie sind auf jeden Fall verschiedene Systeme, auch wenn man Quine sonst zustimmen würde. XI 116 Quine: (dito). Unbestimmtheit der Übersetzung: wegen ihr kann man nicht von einer gegenüber Übersetzungen invarianten Theorie sprechen. Man kann auch nicht sagen, dass eine absolute Theorie in verschiedenen Sprachen formulierbar sei, oder auch umgekehrt, dass verschiedene (sogar einander widersprechende) Theorien in einer Sprache ausgedrückt werden können. ((s) >Wegen der ontologischen Feststellung, dass ich nicht über Ontologie streiten kann, indem ich dem anderen sagen, dass es die Dinge, die es bei ihm gebe, bei mir nicht gibt, weil ich dann den Selbstwiderspruch aufstelle, dass es Dinge gibt, die es nicht gibt). Lauener: das entspräche dem Irrtum, dass die Sprache die Syntax, die Theorie aber den empirischen Gehalt beisteuere. Sprache/Theorie/Quine/Lauener: d.h. nicht, dass es gar keinen Gegensatz zwischen beiden gäbe: insofern dennoch zwei verschiedene Theorien in derselben Sprache niederlegt werden, heißt das dann, dass die Ausdrücke nicht in allen Ausdrücken austauschbar sind. Es gibt aber auch Kontexte, wo die Unterscheidung Sprache/Theorie keinen Sinn hat. Daher ist der Unterschied graduell. Die Kontexte, wo Sprache/Theorie austauschbar sind, sind die, wo Quine von einem Netzwerk spricht. |
Chomsky I Noam Chomsky "Linguistics and Philosophy", in: Language and Philosophy, (Ed) Sidney Hook New York 1969 pp. 51-94 In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Chomsky II Noam Chomsky "Some empirical assumptions in modern philosophy of language" in: Philosophy, Science, and Method, Essays in Honor of E. Nagel (Eds. S. Morgenbesser, P. Suppes and M- White) New York 1969, pp. 260-285 In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Chomsky IV N. Chomsky Aspekte der Syntaxtheorie Frankfurt 1978 Chomsky V N. Chomsky Language and Mind Cambridge 2006 Quine I W.V.O. Quine Wort und Gegenstand Stuttgart 1980 Quine II W.V.O. Quine Theorien und Dinge Frankfurt 1985 Quine III W.V.O. Quine Grundzüge der Logik Frankfurt 1978 Quine V W.V.O. Quine Die Wurzeln der Referenz Frankfurt 1989 Quine VI W.V.O. Quine Unterwegs zur Wahrheit Paderborn 1995 Quine VII W.V.O. Quine From a logical point of view Cambridge, Mass. 1953 Quine VII (a) W. V. A. Quine On what there is In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (b) W. V. A. Quine Two dogmas of empiricism In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (c) W. V. A. Quine The problem of meaning in linguistics In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (d) W. V. A. Quine Identity, ostension and hypostasis In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (e) W. V. A. Quine New foundations for mathematical logic In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (f) W. V. A. Quine Logic and the reification of universals In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (g) W. V. A. Quine Notes on the theory of reference In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (h) W. V. A. Quine Reference and modality In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (i) W. V. A. Quine Meaning and existential inference In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VIII W.V.O. Quine Bezeichnung und Referenz In Zur Philosophie der idealen Sprache, J. Sinnreich (Hg) München 1982 Quine IX W.V.O. Quine Mengenlehre und ihre Logik Wiesbaden 1967 Quine X W.V.O. Quine Philosophie der Logik Bamberg 2005 Quine XII W.V.O. Quine Ontologische Relativität Frankfurt 2003 Quine XIII Willard Van Orman Quine Quiddities Cambridge/London 1987 |
| Performanz Sprache | Searle Vs Tradition | II 28 Überzeugung/SearleVsTradition: sie ist eben nicht eine Art Bild! Sie ist einfach eine Repräsentation, d.h. sie hat einen propositionalen Gehalt, der die Erfüllungsbedingungen festlegt und einen psychischen Modus, der die Ausrichtung festlegt. II 49 SearleVsTradition: Überzeugungen und Wünsche sind nicht die grundlegenden intentionalen Zustände. Man kann sich seines Wunsches oder seiner Überzeugungen auch schämen. II 160 Tradition: man hat niemals ein Verursachungserlebnis. SearleVsTradition: man hat nicht nur häufig ein Verursachungserlebnis, sondern jedes Wahrnehmungs oder Handlungserlebnis ist in der Tat genau ein solches Verursachungserlebnis! SearleVsHume: er hat eine falsche Stelle gesucht, er suchte eine Kraft. II 190 Bsp Skifahren: traditionelle Auffassung: zunächst: Wort auf Welt Verursachungsrichtung. Man leistet der Anweisung Folge, das Gewicht auf den Talski zu legen. II 191 Bei zunehmender Geschicklichkeit ändert sich das. Die Anweisungen wirken unbewusst, aber immer noch als Repräsentation. Bewusst machen wird in Zukunft hinderlich wie beim Tausendfüßler. SearleVsTradition: die Regeln werden nicht verinnerlicht, sondern sie werden immer unwichtiger! Sie werden nicht unbewusst "fest verdrahtet" sondern sie gehen in Fleisch und Blut über. II 192 Vielleicht werden Sie als Nervenbahnen realisiert und machen die Regeln einfach überflüssig. Die Regeln können sich in den Hintergrund zurückziehen. Der Anfänger ist unflexibel, der Fortgeschrittene flexibel. Das macht die kausaler Rolle der Repräsentation hier überflüssig! Der Fortgeschrittene folgt nicht den Regeln besser, erfährt anders Ski! Der Körper übernimmt das Kommando und die Intentionalität des Fahrers wird auf den Rennsieg konzentriert. II 192/193 Hintergrund/Searle: befindet sich nicht an der Peripherie der Intentionalität, sondern durchdringt das ganze Netzwerk intentionaler Zustände. II 228 Name/Gegenstand/direkte Rede/Zitat/Tradition/Searle: Bsp der Sheriff äußerte die Worte »Mr. Howard ist ein ehrlicher Mann«. II 231 Nach der traditionellen Auffassung beinhaltet die wörtliche Rede hier überhaupt keine Wörter! (Sondern Namen.) II 232 SearleVsTradition: natürlich können wir mit Wörtern über Wörter sprechen. Außerdem werden hier keine neuen Namen geschaffen, die syntaktische Position erlaubt häufig nicht einmal die Einsetzung eines Namens. II 233 Bsp Gerald sagte, er werde Henry. (Ungrammatisch). II 246 de dicto/intensional/SearleVsTradition: Bsp "Reagan ist derart, dass Bush ihn für den Präsidenten hält." Searle: der Fehler bestand darin, aus der Intensionalität von de dicto-Berichten auf die Intensionalität der berichteten Zustände selbst zu schließen. Doch aus dem Vorhandensein zweier verschiedener Berichttypen folgt einfach nicht, dass es zwei verschiedene Arten von Zuständen gibt. III 165 Realismus/Tradition/Searle: die alte Streitfrage zwischen Realismus und Idealismus handelte von der Existenz der Materie oder von Objekten im Raum und Zeit. Der traditionelle Realismus beschäftigte sich mit der Frage, wie die Welt in Wirklichkeit ist. Realismus/SearleVsTradition: das ist ein tiefgreifendes Missverständnis! Der Realismus ist keine These darüber, wie die Welt tatsächlich ist. Wir könnten uns völlig im Irrtum darüber befinden, wie die Welt in allen ihren Einzelheiten ist, und der Realismus könnte immer noch wahr sein! Def Realismus/Searle: der Realismus ist die Ansicht, dass es eine Seinsweise der Dinge gibt, die von allen menschlichen Repräsentationen logisch unabhängig ist. Er sagt nicht, wie die Dinge sind, sondern nur, dass es eine Seinsweise der Dinge gibt. (Dinge hier nicht nur materielle Gegenstände). V 176 Prädikat/Bedeutung/Searle: aber ist die Bedeutung des Prädikatausdrucks eine sprachliche oder eine nichtsprachliche Entität? Searle: sie ist in einem ganz gewöhnlichen Sinne eine sprachliche Entität. Kann aus der Existenz einer sprachlichen Entität die Existenz einer nichtsprachlichen Entität folgen? Existenz/Sprache/Universalien/SearleVsTradition: aber die Behauptung, dass irgendwelche nichtsprachlichen Entitäten existieren, kann niemals eine Tautologie darstellen. IV 155 Hintergrund/Searle: was bedeutet "Anwendung" von Hintergrundannahmen? Der Bedeutungsbegriff soll für uns gewisse Aufgaben erledigen. Nun kann derselbe Gegenstand zu verschiedenen Zeiten relativ zu verschiedenen Koordinatensystem von Hintergrundannahmen verstanden werden, ohne mehrdeutig zu sein. ((s) Er ist in der jeweiligen Situation eindeutig). IV 156 SearleVsTradition: hier geht es auch nicht um die Unterscheidung Performanz/Kompetenz. IV 157 Es gibt keine scharfe Trennung zwischen der Kompetenz eines Sprechers und seinem Wissen über die Welt. |
Searle I John R. Searle Die Wiederentdeckung des Geistes Frankfurt 1996 Searle II John R. Searle Intentionalität Frankfurt 1991 Searle III John R. Searle Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit Hamburg 1997 Searle IV John R. Searle Ausdruck und Bedeutung Frankfurt 1982 Searle V John R. Searle Sprechakte Frankfurt 1983 Searle VII John R. Searle Behauptungen und Abweichungen In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Searle VIII John R. Searle Chomskys Revolution in der Linguistik In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Searle IX John R. Searle "Animal Minds", in: Midwest Studies in Philosophy 19 (1994) pp. 206-219 In Der Geist der Tiere, D Perler/M. Wild Frankfurt/M. 2005 |