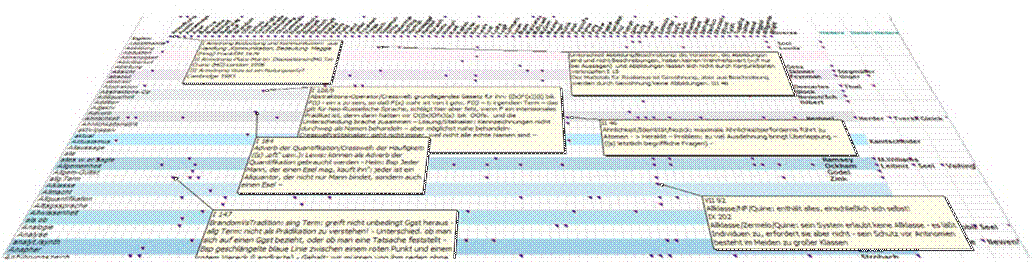Finden Sie Gegenargumente, in dem Sie NameVs…. oder….VsName eingeben.
| Begriff/ Autor/Ismus |
Autor Vs Autor |
Eintrag |
Literatur |
|---|---|---|---|
| Tooley Gesetz | Lewis Vs Armstrong, D. | V 353 "New Work for a Theory of Universals" (Armstrong 1983)(1) Universalien/Armstrong: Seine Theorie der Universalien soll eine Lösung des Problems des Einen und des Vielen sein. >Universalien/Armstrong, >Universalien/Lewis. LewisVsArmstrong: Aber das gestattet entweder nominalistische Lösungen, oder es gestattet überhaupt keine Lösung irgendwelcher Art. --- Schwarz I 71 Kombinatorialismus/Armstrong: Kombinatorialismus besteht lediglich aus einigen fundamentalen Eigenschaften, bei denen - anders als bei Farben – jede Kombination möglich sein soll (1986,§7)(2). LewisVs: (1986a(3), 86, HellerVs (1998)(4)): Es ist nicht klar, ob das überhaupt geht. LewisVsArmstrong: Damit verschiebt sich das Problem aber nur auf die Interpretation der Beschreibungen: Wann repräsentiert so eine Satzmenge, in der von Eseln nicht die Rede ist, dass es Esel gibt? Nur, wenn die Sätze die Existenz von Eseln notwendig implizieren (1986e(5), 150 157). Problem: Das setzt wieder Modalität voraus. VsVs: Man könnte sagen, da die Beziehung zwischen der Verteilung fundamentaler Eigenschaften und allen anderen Wahrheiten analytisch ist, und damit auch ohne primitiv modales Vokabular charakterisierbar ist. (2002b(6), Heller 1996(7), s.u. Kapitel 11. (LewisVs: 1992a(8), 209). Schwarz I 118 Naturgesetze/NG/DretskeVsLewis/TooleyVsLewis/ArmstrongVsLewis: Lewis’ Natugesetzen fehlt etwas: Bei Lewis sind Naturgesetze bloße Regularitäten, sie müssten aber mehr sein. Dretske-Tooley-Armstrong-Theorie: These: NatuGesetze beruhen auf fundamentalen Beziehungen zwischen Universalien, also Eigenschaften. Weil Regularitäten logisch unabhängig von lokalen Ereignissen sind, können sich mögliche Welten (MöWe) mit denselben lokalen Ereignissen gut in ihren NaturGesetzen unterscheiden: Was hier eine bloße Regularität ist, mag dort eine Universalien-Beziehung sein. Universalien-Beziehung: Diese Beziehung ist grundlegend und unanalysierbar. Es genügt nicht zu sagen, es bestehe eine Beziehung zwischen Fs und Gs, weil alle Fs Gs sind. Das wäre die Regularitätstheorie. SchwarzVs: Das gibt Probleme mit uninstantiierten Universalien (Mellor 1980(9), §6). NaturGesetze/LewisVsArmstrong/LewisVsTooley/LewisVsDretske: Wenn NaturGesetze fundamentale Beziehungen zwischen Universalien ausdrücken, die logisch unabhängig sind von beobachtbaren Regularitäten, wieso nehmen wir dann an, dass die Physik uns etwas über NaturGesetze verrät? Schwarz I 119 Welchen Nutzen bringen Universalien? Physiker wollen bloß Regularitäten beobachten. Und was hat die Universalien-Beziehung dann mit noch mit den Regularitäten zu tun? Das muss man dann noch zusätzlich erklären! Wie könnte ein angenommener Gesetzgeber ausschließen, dass N(F,G) gilt und dennoch einige Fs keine Gs sind? Es genügt nicht, dem „Gesetzgeber“ einen Namen zu geben wie Armstrong das tut mit „necessitation“ („Notwendigmachung“). NaturGesetze/LewisVsArmstrong: vielleicht besser: Regularitäten, die zusätzlich durch eine primitive Beziehung zwischen Universalien abgesegnet sind, eine Beziehung, die auch in Welten besteht, in denen das NaturGesetz nicht gilt. Das ist zwar noch obskurer, aber dann ist es wenigstens kein Wunder mehr, dass alle Fs Gs sind, wenn ein NaturGesetz das verlangt. Schwarz I 124 Wahrscheinlichkeit/LewisVsArmstrong: VsFundamentale Wahrscheinlichkeit-Eigenschaft: Fundamentale Eigenschaften können die Rolle nicht erfüllen, die wir Wahrscheinlichkeiten zuschreiben. Schwarz I 139 Ursache/Verursachung/Armstrong: Abwesenheit ist keine echte Ursache. LewisVsArmstrong: Doch, das ist sie. Sie ist bloß so alltäglich, das es folgendes ignoriert: Problem: Im Vakuum gibt es dann unzählige Abwesenheiten. Schwarz I 140 Lösung/Lewis: Abwesenheiten sind überhaupt nichts, da gibt es nichts. Problem: Wenn Abwesenheit bloß eine leere Raumzeit-Region ist, warum gäbe es dann ohne sie gerade Sauerstoff und nicht Stickstoff? > Lösung/Lewis: „Einfluss“: Wir erhöhen die Wahrscheinlichkeit leicht. Dann gibt es eine kontrafaktische Abhängigkeit auch zwischen dem Wie, Wann und Wo des Geschehens. Schwarz I 231 Def Wahrmacher-Prinzip/Wahrmachen/Armstrong/Martin/Schwarz: Alle Wahrheiten müssen in der Ontologie verankert sein. Starke Form: Für jede Wahrheit existiert etwas, das sie wahr macht, dessen Existenz die Wahrheit notwendig impliziert. LewisVsArmstrong: das ist zu stark: Bsp Dass „Es gibt keine Einhörner“ wahr ist, liegt nicht daran, dass es etwas bestimmtes gibt, sondern daran, dass es Einhörner gerade nicht gibt. (1992a(8), 204, 2001b(10), 611f). Wahrmacher: Ein Wahrmacher wäre hier ein Gegenstand, der nur in Welten existiert, in denen es keine Einhörner gibt. Problem: Warum kann dieser Gegenstand nicht auch in Welten mit Einhörnern existieren?. Antwort: Weil ein solcher Gegenstand dem Rekombinationsprinzip widerspräche. SchwarzVsLewis: Das stimmt aber nicht. Der Wahrmacher für „es gibt keine Einhörner“ könnte ein Ding sein, das essentiell in einer Welt ohne Einhörner lebt, aber durchaus Duplikate in möglichen Welten mit Einhörnern hat. Die Gegenstückrelation ist keine Beziehung intrinsischer Ähnlichkeit. Wahrmachen/Prädikat/Armstrong/Schwarz: (Armstrong 1997a(11), 205f): Wenn ein Ding A eine Eigenschaft F hat, muss es einen Gegenstand geben, dessen Existenz diese Tatsache impliziert. LewisVsArmstrong: Warum kann dieser Gegenstand nicht existieren, obwohl A nicht F ist? (1998b)(12). Warum muss immer, wenn in einer Welt A F ist und in einer anderen nicht, in der einen auch etwas existieren, das in der anderen Welt fehlt? Zwei Welten können sich auch nur darin unterscheiden, was für Eigenschaften die Dinge in ihnen haben ((s) Also bei konstant gehaltenem Gegenstandsbereich andere Eigenschaften). Eigenschaft/Wahrmacher/Lewis: Dass etwas eine (grundlegende) Eigenschaft hat, benötigt also keine Wahrmacher. Der Satz, dass A F ist, ist wahr, weil A die Eigenschaft F hat. Das ist alles. (1998b(12), 219). Def Wahrmacher-Prinzip/LewisVsArmstrong/Schwarz: Es bleibt dann nur übrig: Wahrheit superveniert darauf, welche Dinge es gibt und welche perfekt natürlichen Eigenschaften und Relationen sie instantiieren. (1992a(8), 207, 1994a(13), 225, Bigelow 1988(14), §25). Wann immer sich zwei Möglichkeiten unterscheiden, gibt es in ihnen entweder verschiedene Gegenstände oder diese Gegenstände haben verschiedene fundamentale Eigenschaften (1992a(8), 206, 2001b(10), §4). Schwarz I 232 Anmerkung: Wenn es qualitativ ununterscheidbare, aber numerisch verschiedene Möglichkeiten gibt, (was Lewis weder behauptet noch bestreitet, 1986e(5), 224) muss das Prinzip auf qualitative Wahrheiten bzw. Eigenschaften beschränkt werden (1992a(8), 206f). Wenn es keine gibt, lässt es sich vereinfachen: keine zwei Möglichkeiten stimmen exakt darin überein, was für Dinge es gibt und welche fundamentalen Eigenschaften sie instantiieren. ((s) Wenn die Verteilung fundamentaler Eigenschaften alles festlegt, sind die Dinge damit gegeben, und die möglichen Welten könnten sich nur in Eigenschaften unterscheiden, aber die sind ja gerade festgelegt). Schwarz: Das kann noch etwas verstärkt werden. 1. D. M. Armstrong [1983]: What is a Law of Nature?. Cambridge: Cambridge University Press. 2. D. M. Armstrong [1986]: “The Nature of Possibility”. Canadian Journal of Philosophy, 16: 575–594. 3. D. Lewis [1986a]: “Against Structural Universals”. Australasian Journal of Philosophy, 64: 25–46. 4. Mark Heller [1998]: “Property Counterparts in Ersatz Worlds”. Journal of Philosophy, 95: 293–316. 5. D. Lewis [1986e]: On the Plurality of Worlds. Malden (Mass.): Blackwell. 6. D. Lewis [2002b]: “Tharp’s Third Theorem”. Analysis, 62: 95–97. 7. Mark Heller [1996]: “Ersatz Worlds and Ontological Disagreement”. Acta Analytica, 40: 35–44. 8. D. Lewis [1992a]: “Critical Notice of Armstrong, A Combinatorial Theory of Possibility”, Australasian Journal of Philosophy, 70: 211–224, in: [Lewis 1999a]: “Armstrong on Combinatorial Possibility”. 9. David H. Mellor [1980]: “Necessities and universals in natural laws”. In David H. Mellor (Hg.) Science, belief and behaviour, Cambridge: Cambridge University Press. 10. D. Lewis [2001b]: “Truthmaking and Difference-Making”. Noˆus, 35: 602–615. 11. D. M. Armstrong [1997]: A World of States of Affairs. Cambridge: Cambridge University Press. 12. D. Lewis [1998b]: “A World of Truthmakers?” Times Literary Supplement , 4950: 30. 13. D. Lewis [1994a]: “Humean Supervenience Debugged”. Mind, 103: 473–490. 14. John Bigelow [1988]: The Reality of Numbers: A Physicalist’s Philosophy of Mathematics. Oxford: Clarendon Press. |
Lewis I David K. Lewis Die Identität von Körper und Geist Frankfurt 1989 Lewis I (a) David K. Lewis An Argument for the Identity Theory, in: Journal of Philosophy 63 (1966) In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis I (b) David K. Lewis Psychophysical and Theoretical Identifications, in: Australasian Journal of Philosophy 50 (1972) In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis I (c) David K. Lewis Mad Pain and Martian Pain, Readings in Philosophy of Psychology, Vol. 1, Ned Block (ed.) Harvard University Press, 1980 In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis II David K. Lewis "Languages and Language", in: K. Gunderson (Ed.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol. VII, Language, Mind, and Knowledge, Minneapolis 1975, pp. 3-35 In Handlung, Kommunikation, Bedeutung, Georg Meggle Frankfurt/M. 1979 Lewis IV David K. Lewis Philosophical Papers Bd I New York Oxford 1983 Lewis V David K. Lewis Philosophical Papers Bd II New York Oxford 1986 Lewis VI David K. Lewis Konventionen Berlin 1975 LewisCl Clarence Irving Lewis Collected Papers of Clarence Irving Lewis Stanford 1970 LewisCl I Clarence Irving Lewis Mind and the World Order: Outline of a Theory of Knowledge (Dover Books on Western Philosophy) 1991 Schw I W. Schwarz David Lewis Bielefeld 2005 |
| Tooley Gesetz | Verschiedene Vs Humesche Supervenienz | Schwarz I 114 VsHumesche Supervenienz/HS/VsLewis/Schwarz: schwerwiegender: Überlegungen, die zeigen sollen, dass nomologische und kontrafaktische Wahrheiten nicht auf der Verteilung lokaler Eigenschaften supervenieren. Angenommen, es gibt ein grundlegendes NaturGesetz, nach dem bei einem Zusammentreffen von X- und Y-Teilchen, stets ein Z-Teilchen entsteht. Rein zufällig treffen X- und Y-Teilchen aber nie zusammen. Die Welt w1, in der dieses NaturGesetz (NG) existiert, sähe dann genau so aus, wie die Welt w2, in der es nicht existiert. Beide Welten stimmen in der Verteilung lokaler Eig überein. Aber sie unterscheiden sich in ihren NG und vor allem in ihren kontrafaktischen Wahrheiten. (In w1 entstünde bei einer Kollision ein Teilchen). (Tooley 1977(1), 669 671, 2003,§4,Armstrong 1983(2),§5.4,Carroll 1994(3),§3.1) 1. Michael Tooley [1977]: “The Nature of Laws”. Canadian Journal of Philosophy, 4: 667–698 2. David. M. Armstrong [1983]: What is a Law of Nature?. Cambridge: Cambridge University Press 3. John Carroll [1994]: Laws of Nature. Cambridge: Cambridge University Press |
Schw I W. Schwarz David Lewis Bielefeld 2005 |
| Tooley Gesetz | Armstrong Vs Platon | Arm III 90 ArmstrongVsTichy: es scheint klar, dass Gesetze, obwohl Zustände (states of affairs) und real, Abstraktionen sind. D.h. sie können nicht unabhängig von anderen Dingen existieren. Universale: kann nicht nur aus Gesetzen bestehen und nichts sonst. ArmstrongVsPlaton: Universalien sind Abstraktionen. aber nicht im Sinne von Quine und vieler nordamerikanischer Philosophen: III 91 abstrakt/Quine: nennt Platonische Universalien "abstrakt". (In anderem Sinn als Armstrongs Universalien als Abstraktionen). Abstraktion/Armstrong: eine Relation zwischen Abstraktionen ist selbst eine Abstraktion. Arm III 126 Universalien/ArmstrongVsPlaton: kontingent, genau wie Einzeldinge! D.h. sie existieren eben nicht uninstantiiert. Daher scheint es überhaupt nicht plausibel, dass wenn ein nichtexistierendes U zur Existenz gelangte (Tooley) es eine bestimmte Relation zu anderen hätte oder nach dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten eben nicht hätte. Fazit: Tooleys geniale Beispiele halten uns nicht davon ab, uninstantiierte Gesetze als verschleierte kontrafaktische Konditionale (KoKo) zu verstehen, deren Wahrheit oder Falschheit völlig vom Aktualen abhängt, d.h. von instantiierten Gesetzen (höherer Stufe!). Das "Gesetz" von dem man annimmt, dass es danach eintritt, mag niemals eintreten. Dennoch mag es spezifiziert sein. |
Armstrong I David M. Armstrong Meaning and Communication, The Philosophical Review 80, 1971, pp. 427-447 In Handlung, Kommunikation, Bedeutung, Georg Meggle Frankfurt/M. 1979 Armstrong II (a) David M. Armstrong Dispositions as Categorical States In Dispositions, Tim Crane London New York 1996 Armstrong II (b) David M. Armstrong Place’ s and Armstrong’ s Views Compared and Contrasted In Dispositions, Tim Crane London New York 1996 Armstrong II (c) David M. Armstrong Reply to Martin In Dispositions, Tim Crane London New York 1996 Armstrong II (d) David M. Armstrong Second Reply to Martin London New York 1996 Armstrong III D. Armstrong What is a Law of Nature? Cambridge 1983 |
| Tooley Gesetz | Armstrong Vs Regularitätstheorie | Armstrong III 13 ArmstrongVsRegularitätstheorie: 1. extensionale Probleme: A. Humesche Gleichförmigkeit: es scheint welche zu geben, die keine NaturGesetze sind sind. (HG = Humesche Gleichförmigkeit). D.h. eine HG zu sein, ist nicht hinreichend dafür, ein NG zu sein. B. NG: es könnte welche geben, die nicht universell in Zeit und Raum gelten. Es gibt auch WahrscheinlichkeitsGesetze (WschkG). Keine dieser beiden wären Humesche Gleichförmigkeiten (HG). D.h. eine HG zu sein, ist nicht notwendig dafür, ein NG zu sein. 2. "intensionale" Probleme: angenommen, es gibt eine HG, der ein NG entspricht, und der Inhalt dieser Gleichförmigkeit ist derselbe wie der des Gesetzes. Selbst dann gibt es Gründe anzunehmen, dass das Gesetz und die Gleichförmigkeit nicht identisch sind. Arm III 25 TooleyVsArmstrong: (s.u.): Naturgesetze, die wesentlich Einzeldinge involvieren, müssen als logisch möglich zugelassen werden. Dann muss es erlaubt sein, dass sich Gesetze von einer komischer Epoche zur nächsten ändern. TooleyVsRegularitätstheorie: für sie ist es ein Problem, dass nur eine schmale begriffliche Lücke die kosmischen Epochen (d.h. HG) von einfach nur sehr groß ausgedehnten Gleichförmigkeiten trennt, die nicht mehr kosmisch sind., Angenommen, es gäbe keine kosmischen Gleichförmigkeiten (GF), aber wohl die ausgedehnten, dann ist das logisch kompatibel mit all unseren Beobachtungen. VsRegth: wie soll sie die Situation beschreiben, dass es a) keine Gesetze gibt aber ausgedehnte Gleichförmigkeiten? oder b) dass es Gesetze gibt, aber diese nicht kosmische Reichweite haben? Dem Geist der Regth entspricht eher letzteres. III 27 VsRegth: sie kann nicht behaupten, dass jede lokale GF ein Gesetz ist. III 52 ArmstrongVsRegth: macht Induktion irrational. Arm III 159 ArmstrongVsIdealismus: zur Annahme eines unerklärten Absoluten gezwungen, wegen der Vorraussetzung der Notwendigkeit der Existenz. Es gibt keine Prinzipien der Deduktion vom Absoluten abwärts. Es hat nie eine ernsthafte solche Deduktion gegeben. Erklärung/Armstrong: wenn aber die Erklärung kurz vor dem Absoluten halten muss, dann muss auch der Idealismus Kontingenz akzeptieren. An welchem Punkt sollten wir die Kontingenz akzeptieren? ArmstrongVsRegularitätstheorie: diese gibt zu früh auf. Universalientheorie: können die atomaren Verbindungen von Universalien die wir für die molekularen Gleichförmigkeiten angenommen haben, erklärt werden? Notwendigkeit/Armstrong: kann immer nur behauptet werden, sie kann nicht gezeigt werden oder auch nur plausibel gemacht werden. Arm III 53 Induktion/ArmstrongVsRegularitätstheorie: 1. Induktion ist rational. Wir bewältigen mit ihr unser Leben. Der Schluss ist formal ungültig, und es ist ausgesprochen schwierig, ihn zu formalisieren. HumeVsInduktion: mit seinem Skeptizismus gegen Induktion hat er einen Grundpfeiler unseres Lebens in Frage gestellt. (Viel schlimmer als Skeptizismus in Bezug auf Gott). Moore: verteidigte Induktion wegen des common sense. Armstrong pro. III 54 Das beste, was der Skeptiker VsInduktion erhoffen kann, ist einige unserer am besten begründeten (induktiv gewonnenen) Alltagsgewissheiten gegeneinander auszuspielen. VsVs: es ist ein kohärentes System, dass unsere Alltagsgewissheiten (Glauben) ein kohärentes System bilden. Anwendung auf sich selbst. Hume: der Zweifel daran beinhalten ein Quantum an mauvaise foi. (Armstrong dito). Er bleibt nur während seiner Studien Skeptiker und verwirft den Skeptizismus im Alltag. VsRegth: es ist daher ein schwerer Vorwurf gegen eine philosophische Theorie, wenn sie auf den Skeptizismus VsInduktion verpflichtet ist. |
Armstrong I David M. Armstrong Meaning and Communication, The Philosophical Review 80, 1971, pp. 427-447 In Handlung, Kommunikation, Bedeutung, Georg Meggle Frankfurt/M. 1979 Armstrong II (a) David M. Armstrong Dispositions as Categorical States In Dispositions, Tim Crane London New York 1996 Armstrong II (b) David M. Armstrong Place’ s and Armstrong’ s Views Compared and Contrasted In Dispositions, Tim Crane London New York 1996 Armstrong II (c) David M. Armstrong Reply to Martin In Dispositions, Tim Crane London New York 1996 Armstrong II (d) David M. Armstrong Second Reply to Martin London New York 1996 Armstrong III D. Armstrong What is a Law of Nature? Cambridge 1983 |
| Tooley Gesetz | Armstrong Vs Tooley, M. | III 104 Tooley: wenn Relation zwischen Universalien Wahrmacher sind, dann sine diese "atomare Tatsachen". dann könnten die Standardprinzipien der Bestätigungstheorie eine Wahrscheinlichkeit > 0 zuschreiben. III 105 ArmstrongVsTooley: das ist eine Anfangsmöglichkeit oder logische Möglichkeit einer Tautologie. da sollten Empiriker Zweifel haben. ForrestVsTooley: es könnte unendlich viele mögliche Universalien geben. Wäre dann die zuschreibbaren Anfangswahrscheinlichkeiten nicht infinitesimal klein? Das wäre keine Rechtfertigung für die Induktion. VsInduktion/VsBeste Erklärung: der induktive Skeptizismus könnte bezweifeln, daß es wirklich die beste Erklärung wäre, fundamentaler: warum sollten die Gleichförmigkeiten (GF) der Welt überhaupt eine Erklärung haben? GF/Berkeley: durch Gott. Dieser könnte die "NaturGesetze" auch morgen abschaffen. Berkeley/Armstrong: darauf zu antworten heißt schon, die Möglichkeit zuzugestehen. Wir haben keine Garantie, daß die Beste Erklärung das beste Schema ist. Aber es ist informativ. Arm III 120 … Dann wären alle Universalen nur Substanzen im Humeschen Sinn: d.h. etwas, das logisch möglicherweise eine unabhängige Existenz hat. III 121 ArmstrongVsHume/ArmstronVsTooley: es ist falsch, sich Universalien so vorzustellen. Dann gibt es Probleme, wie Universalien mit ihren Einzeldingen (ED) zusammenhängen sollen. Bsp wenn eine Rel zwischen ED a und b etwas ist, was einer unabhängigen Existenz fähig ist , ohne a und b, und irgendwelcher anderer ED, wird es dann nicht wenigstens eine weitere Rel geben müssen, um sie mit a und b in Verbindungen zu bringen? Und wenn diese Rel. nun selbst uninstantiiert sein kann, (z.B. in einem Universum mit Monaden!) dann steht diese Rel genauso in Frage usw. ad infinitum. (Bradleyscher Regreß). Dem kann man nur entgehen, wenn Universalien bloß abstrakte Faktoren von Zuständen sind (aber real). |
Armstrong I David M. Armstrong Meaning and Communication, The Philosophical Review 80, 1971, pp. 427-447 In Handlung, Kommunikation, Bedeutung, Georg Meggle Frankfurt/M. 1979 Armstrong II (a) David M. Armstrong Dispositions as Categorical States In Dispositions, Tim Crane London New York 1996 Armstrong II (b) David M. Armstrong Place’ s and Armstrong’ s Views Compared and Contrasted In Dispositions, Tim Crane London New York 1996 Armstrong II (c) David M. Armstrong Reply to Martin In Dispositions, Tim Crane London New York 1996 Armstrong II (d) David M. Armstrong Second Reply to Martin London New York 1996 Armstrong III D. Armstrong What is a Law of Nature? Cambridge 1983 |
| Tooley Gesetz | Lewis Vs Tooley, M. | Schwarz I 119 Naturgesetze/NG/Reduktionismus/LewisVsTooley: Das ist der Preis für anti-reduktionistische Intuitionen. Es klingt schön und gut, dass Naturgesetze nicht auf lokalen Ereignissen supervenieren, dass unsere Begriffe von Naturgesetzen, kontrafaktischen Wahrheiten und Kausalität nicht auf außerhalb liegendes reduziert werden können (Tooley 1987(1), 2003(2)). Problem: Die offensichtlichsten Merkmale von Naturgesetzen werden damit unbegreiflich! Lewis: (als Reduktionist) kann demgegenüber erklären, warum man die NaturGesetze empirisch entdecken kann, warum die Physik auf dem Weg dazu ist, warum es nützlich ist, die NaturGesetze zu kennen, und warum alle Fs überhaupt Gs sind, wenn „alle Fs sind Gs“ ein NaturGesetz ist. Als Anti-Reduktionist muss man all dies bloß mit Demut zur Kenntnis nehmen. Lewis: Die Annahme einer primitiven modalen Tatsache, die sicherstellt, dass in jeder möglichen Welt (MöWe) in der N(F,G) besteht, auch alle Fs Gs sind, ist obskur und fast sinnlos: Wenn es keine Möwe gibt, in denen N(F,G) besteht, aber einige Fs nicht G sind, dann muss das eine Erklärung haben, dann muss an der Vorstellung solcher Welten etwas inkohärent sein (s.o. 3,2). Mögliche Welten können nicht einfach fehlen. NaturGesetze/LewisVsArmstrong: vielleicht besser: NaturGesetze sind Regularitäten, die zusätzlich durch eine primitive Beziehung zwischen Universalien abgesegnet sind, eine Beziehung, die auch in möglichen Welten besteht, in denen das NaturGesetz nicht gilt. Das ist zwar noch obskurer, aber dann ist es wenigstens kein Wunder mehr, dass alle Fs Gs sind, wenn ein NaturGesetz das verlangt. 1. Michael Tooley [1987]: Causation: A Realist Approach. Oxford: Oxford University Press. 2. Michael Tooley [2003]: “Causation and Supervenience”. In [Loux und Zimmerman 2003]. |
Lewis I David K. Lewis Die Identität von Körper und Geist Frankfurt 1989 Lewis I (a) David K. Lewis An Argument for the Identity Theory, in: Journal of Philosophy 63 (1966) In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis I (b) David K. Lewis Psychophysical and Theoretical Identifications, in: Australasian Journal of Philosophy 50 (1972) In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis I (c) David K. Lewis Mad Pain and Martian Pain, Readings in Philosophy of Psychology, Vol. 1, Ned Block (ed.) Harvard University Press, 1980 In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis II David K. Lewis "Languages and Language", in: K. Gunderson (Ed.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol. VII, Language, Mind, and Knowledge, Minneapolis 1975, pp. 3-35 In Handlung, Kommunikation, Bedeutung, Georg Meggle Frankfurt/M. 1979 Lewis IV David K. Lewis Philosophical Papers Bd I New York Oxford 1983 Lewis V David K. Lewis Philosophical Papers Bd II New York Oxford 1986 Lewis VI David K. Lewis Konventionen Berlin 1975 LewisCl Clarence Irving Lewis Collected Papers of Clarence Irving Lewis Stanford 1970 LewisCl I Clarence Irving Lewis Mind and the World Order: Outline of a Theory of Knowledge (Dover Books on Western Philosophy) 1991 Schw I W. Schwarz David Lewis Bielefeld 2005 |
Der gesuchte Begriff oder Autor findet sich in folgenden 2 Thesen von Autoren des zentralen Fachgebiets.
| Begriff/ Autor/Ismus |
Autor |
Eintrag |
Literatur |
|---|---|---|---|
| NaturGesetze | Armstrong, D.M. | Lewis V XII Naturgesetze/Lewis: ich widerspreche den "unHumeschen Gesetzemachern" (z.B. Armstrong): sie können ihr eigenes Projekt nicht durchführen. Def NaturGesetze/Armstrong: These N sei eine "Gesetzmachende Relation" (lawmaker relation), dann ist es eine kontingente Tatsache, und eine, die nicht auf dem AvQ superveniert, welche Universalien in dieser Relation N stehen. Aber es ist dennoch irgendwie notwendig daß, wenn N(F,G) es eine Regularität geben muß, daß alle F"s G"s sind. Lewis/Schw I 118 Dretske-Tooley-Armstrong-Theorie: These NG beruhen auf fundamentalen Beziehungen zwischen Universalien, also Eigenschaften. Weil Regularitäten logisch unabhängig von lokalen Ereignissen sind, können sich mögliche Welten mit denselben lokalen Ereignissen gut in ihren Naturgesetzen unterscheiden: was hier eine bloße Regularität ist, mag dort eine Universalien-Beziehung sein. Universalien-Beziehung: ist grundlegend und unanalysierbar. Es genügt nicht zu sagen, es bestehe eine Beziehung zwischen Fs und Gs, weil alle Fs Gs sind. Das wäre die Regularitäts-Theorie. Schurz I 239 NG/Armstrong: These: sind Implikationsbeziehungen zwischen Universalien. Daher kein Bezug auf Individuen. (1983) Maxwell-Bedingung/Wilson/Schurz: (Wilson 1979) |
Schu I G. Schurz Einführung in die Wissenschaftstheorie Darmstadt 2006 |
| NaturGesetze | Drestke, F. | Schwarz I 118 Dretske-Tooley-Armstrong-Theorie: These. Naturgesetze (NG) beruhen auf fundamentalen Beziehungen zwischen Universalien, also Eigenschaften. Weil Regularitäten logisch unabhängig von lokalen Ereignissen sind, können sich mögliche Welten mit denselben lokalen Ereignissen gut in ihren Naturgesetzen unterscheiden: was hier eine bloße Regularität ist, mag dort eine Universalien-Beziehung sein. Universalien-Beziehung: ist grundlegend und unanalysierbar. Es genügt nicht zu sagen, es bestehe eine Beziehung zwischen Fs und Gs, weil alle Fs Gs sind. Das wäre die Regularitäts-Theorie. |
Schw I W. Schwarz David Lewis Bielefeld 2005 |
Der gesuchte Begriff oder Autor findet sich in folgenden Thesen von Autoren angrenzender Fachgebiete:
| Begriff/ Autor/Ismus |
Autor |
Eintrag |
Literatur |
|---|---|---|---|
| NaturGesetze | Tooley, M. | Lewis/Schw I 118 Dretske-Tooley-Armstrong-Theorie: These: Naturgesetze (NG) beruhen auf fundamentalen Beziehungen zwischen Universalien, also Eigenschaften. Weil Regularitäten logisch unabhängig von lokalen Ereignissen sind, können sich mögliche Welten mit denselben lokalen Ereignissen gut in ihren Naturgesetzen unterscheiden: was hier eine bloße Regularität ist, mag dort eine Universalien-Beziehung sein. Universalien-Beziehung: ist grundlegend und unanalysierbar. Es genügt nicht zu sagen, es bestehe eine Beziehung zwischen Fs und Gs, weil alle Fs Gs sind. Das wäre die Regularitätstheorie. |
|