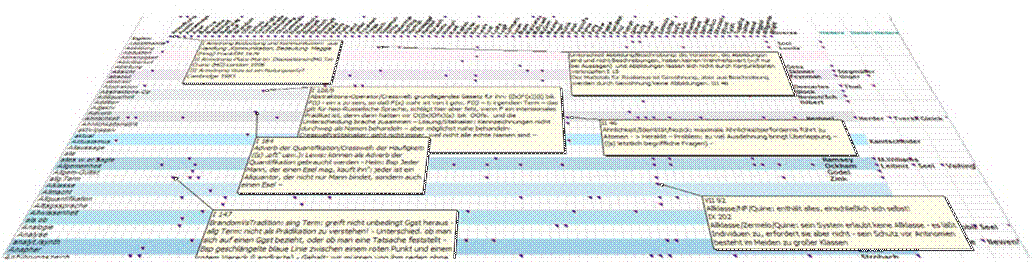Finden Sie Gegenargumente, in dem Sie NameVs…. oder….VsName eingeben.
Der gesuchte Begriff oder Autor findet sich in folgenden 3 Einträgen:
| Begriff/ Autor/Ismus |
Autor |
Eintrag |
Literatur |
|---|---|---|---|
| Schach | KI-Forschung | Norvig I 192 Schach/Künstliche Intelligenz/Norvig/Russell: Schach war eine der ersten in der KI durchgeführten Aufgaben, mit frühen Bemühungen vieler Pioniere der Informatik, darunter Konrad Zuse 1945, Norbert Wiener in seinem Buch Kybernetik (1948)(1) und Alan Turing 1950 (siehe Turing et al., 1953)(2). Aber es war Claude Shannons Artikel Programming a Computer for Playing Chess (1950)(3), der den vollständigsten Satz von Ideen hatte, der eine Repräsentation für Brettpositionen, eine Bewertungsfunktion, Ruhesuche (quiescence search) und einige Ideen für die selektive (nicht erschöpfende) game-tree search beschrieb. Slater (1950)(4) und die Kommentatoren seines Artikels untersuchten auch die Möglichkeiten des Computerschachspiels. D. G. Prinz (1952)(5) absolvierte ein Programm, das Probleme beim Endspiel im Schach löste, aber kein vollständiges Spiel spielte. Stan Ulam und eine Gruppe des Los Alamos National Lab erstellten ein Programm, das Schach auf einem 6×6 Brett ohne Läufer spielte (Kister et al., 1957)(6). Es konnte 4 Halbzüge (plies) deep in ca. 12 Minuten durchsuchen. Alex Bernstein schrieb das erste dokumentierte Programm, das eine vollständige Standardschachpartie spielte (Bernstein und Roberts, 1958)(7). Das erste Computerschachspiel beinhaltete das Kotok-McCarthy-Programm des MIT (Kotok, 1962)(8) und das ITEP-Programm, das Mitte der 1960er Jahre am Moskauer Institut für theoretische und experimentelle Physik geschrieben wurde (Adelson-Velsky et al., 1970)(9). Das erste Schachprogramm, das erfolgreich mit Menschen konkurrierte, war MACHACK-6 von MIT(Greenblatt et al., 1967)(10). Der Preis in Höhe von 10.000 US-Dollar für das erste Programm, das eine USCF-Bewertung (United States Chess Federation) von 2500 (nahe der Großmeisterstufe) erreichte, wurde 1989 an DEEP THOUGHT (Hsu et al., 1990)(11) vergeben. Der Hauptpreis, 100.000 Dollar, ging an DEEP BLUE (Campbell et al., 2002(12); Hsu, 2004(13)) für seinen bahnbrechenden Sieg über Weltmeister Garry Kasparov in einem Freundschaftsspiel 1997. Norvig I 193 HYDRA (Donninger und Lorenz, 2004(14)) wird zwischen 2850 und 3000 bewertet, was hauptsächlich auf dem Sieg über Michael Adams basiert. Das RYBKA-Programm wird zwischen 2900 und 3100 bewertet, aber dies basiert auf einer kleinen Anzahl von Spielen und gilt nicht als zuverlässig. Ross (2004)(15) zeigt, wie menschliche Spieler gelernt haben, einige der Schwächen der Computerprogramme auszunutzen. 1. Wiener, N. (1948). Cybernetics. Wiley. 2. Turing, A., Strachey, C., Bates,M. A., and Bowden, B. V. (1953). Digital computers applied to games. In Bowden, B. V. (Ed.), Faster than Thought, pp. 286 - 310. Pitman. 3. Shannon, C. E. (1950). Programming a computer for playing chess. Philosophical Magazine, 41(4), 256–275 4. Slater, E. (1950). Statistics for the chess computer and the factor of mobility. In Symposium on Information Theory, pp. 150-152. Ministry of Supply 5. Prinz, D. G. (1952). Robot chess. Research, 5, 261- 266. 6. Kister, J., Stein, P., Ulam, S., Walden, W., and Wells, M. (1957). Experiments in chess. JACM, 4, 174–177. 7. Bernstein, A. and Roberts, M. (1958). Computer vs. chess player. Scientific American, 198(6), 96- 105. 8. Kotok, A. (1962). A chess playing program for the IBM 7090. AI project memo 41, MIT Computation Center. 9. Adelson-Velsky, G. M., Arlazarov, V. L., Bitman, A. R., Zhivotovsky, A. A., and Uskov, A. V. (1970). Programming a computer to play chess. Russian Mathematical Surveys, 25, 221-262. 10. Greenblatt, R. D., Eastlake, D. E., and Crocker, S. D. (1967). The Greenblatt chess program. In Proc. Fall Joint Computer Conference, pp. 801-810. 11. Hsu, F.-H., Anantharaman, T. S., Campbell, M. S., and Nowatzyk, A. (1990). A grandmaster chess machine. Scientific American, 263(4), 44–50. 12. Campbell, M. S., Hoane, A. J., and Hsu, F.-H. (2002). Deep Blue. AIJ, 134(1–2), 57–83. 13. Hsu, F.-H. (2004). Behind Deep Blue: Building the Computer that Defeated the World Chess Champion. Princeton University Press. 14. Donninger, C. and Lorenz, U. (2004). The chess monster hydra. In Proc. 14th International Conference on Field-Programmable Logic and applications, pp. 927-932. 15. Ross, P. E. (2004). Psyching out computer chess players. IEEE Spectrum, 41(2), 14-15. |
Norvig I Peter Norvig Stuart J. Russell Artificial Intelligence: A Modern Approach Upper Saddle River, NJ 2010 |
| Schach | Norvig | Norvig I 192 Schach/Künstliche Intelligenz/Norvig/Russell: Schach war eine der ersten in der KI durchgeführten Aufgaben, mit frühen Bemühungen vieler Pioniere der Informatik, darunter Konrad Zuse 1945, Norbert Wiener in seinem Buch Kybernetik (1948)(1) und Alan Turing 1950 (siehe Turing et al., 1953)(2). Aber es war Claude Shannons Artikel Programming a Computer for Playing Chess (1950)(3), der den vollständigsten Satz von Ideen hatte, der eine Repräsentation für Brettpositionen, eine Bewertungsfunktion, Ruhesuche (quiescence search) und einige Ideen für die selektive (nicht erschöpfende) game-tree search beschrieb. Slater (1950)(4) und die Kommentatoren seines Artikels untersuchten auch die Möglichkeiten des Computerschachspiels. D. G. Prinz (1952)(5) absolvierte ein Programm, das Probleme beim Endspiel im Schach löste, aber kein vollständiges Spiel spielte. Stan Ulam und eine Gruppe des Los Alamos National Lab erstellten ein Programm, das Schach auf einem 6×6 Brett ohne Läufer spielte (Kister et al., 1957)(6). Es konnte 4 Halbzüge (plies) deep in ca. 12 Minuten durchsuchen. Alex Bernstein schrieb das erste dokumentierte Programm, das eine vollständige Standardschachpartie spielte (Bernstein und Roberts, 1958)(7). Das erste Computerschachspiel beinhaltete das Kotok-McCarthy-Programm des MIT (Kotok, 1962)(8) und das ITEP-Programm, das Mitte der 1960er Jahre am Moskauer Institut für theoretische und experimentelle Physik geschrieben wurde (Adelson-Velsky et al., 1970)(9). Das erste Schachprogramm, das erfolgreich mit Menschen konkurrierte, war MACHACK-6 von MIT(Greenblatt et al., 1967)(10). Der Preis in Höhe von 10.000 US-Dollar für das erste Programm, das eine USCF-Bewertung (United States Chess Federation) von 2500 (nahe der Großmeisterstufe) erreichte, wurde 1989 an DEEP THOUGHT (Hsu et al., 1990)(11) vergeben. Der Hauptpreis, 100.000 Dollar, ging an DEEP BLUE (Campbell et al., 2002(12); Hsu, 2004(13)) für seinen bahnbrechenden Sieg über Weltmeister Garry Kasparov in einem Freundschaftsspiel 1997. Norvig I 193 HYDRA (Donninger und Lorenz, 2004(14)) wird zwischen 2850 und 3000 bewertet, was hauptsächlich auf dem Sieg über Michael Adams basiert. Das RYBKA-Programm wird zwischen 2900 und 3100 bewertet, aber dies basiert auf einer kleinen Anzahl von Spielen und gilt nicht als zuverlässig. Ross (2004)(15) zeigt, wie menschliche Spieler gelernt haben, einige der Schwächen der Computerprogramme auszunutzen. 1. Wiener, N. (1948). Cybernetics. Wiley. 2. Turing, A., Strachey, C., Bates,M. A., and Bowden, B. V. (1953). Digital computers applied to games. In Bowden, B. V. (Ed.), Faster than Thought, pp. 286 - 310. Pitman. 3. Shannon, C. E. (1950). Programming a computer for playing chess. Philosophical Magazine, 41(4), 256–275 4. Slater, E. (1950). Statistics for the chess computer and the factor of mobility. In Symposium on Information Theory, pp. 150-152. Ministry of Supply 5. Prinz, D. G. (1952). Robot chess. Research, 5, 261- 266. 6. Kister, J., Stein, P., Ulam, S., Walden, W., and Wells, M. (1957). Experiments in chess. JACM, 4, 174–177. 7. Bernstein, A. and Roberts, M. (1958). Computer vs. chess player. Scientific American, 198(6), 96- 105. 8. Kotok, A. (1962). A chess playing program for the IBM 7090. AI project memo 41, MIT Computation Center. 9. Adelson-Velsky, G. M., Arlazarov, V. L., Bitman, A. R., Zhivotovsky, A. A., and Uskov, A. V. (1970). Programming a computer to play chess. Russian Mathematical Surveys, 25, 221-262. 10. Greenblatt, R. D., Eastlake, D. E., and Crocker, S. D. (1967). The Greenblatt chess program. In Proc. Fall Joint Computer Conference, pp. 801-810. 11. Hsu, F.-H., Anantharaman, T. S., Campbell, M. S., and Nowatzyk, A. (1990). A grandmaster chess machine. Scientific American, 263(4), 44–50. 12. Campbell, M. S., Hoane, A. J., and Hsu, F.-H. (2002). Deep Blue. AIJ, 134(1–2), 57–83. 13. Hsu, F.-H. (2004). Behind Deep Blue: Building the Computer that Defeated the World Chess Champion. Princeton University Press. 14. Donninger, C. and Lorenz, U. (2004). The chess monster hydra. In Proc. 14th International Conference on Field-Programmable Logic and applications, pp. 927-932. 15. Ross, P. E. (2004). Psyching out computer chess players. IEEE Spectrum, 41(2), 14-15. |
Norvig I Peter Norvig Stuart J. Russell Artificial Intelligence: A Modern Approach Upper Saddle River, NJ 2010 |
| Schach | Russell | Norvig I 192 Schach/Künstliche Intelligenz/Norvig/Russell: Schach war eine der ersten in der KI durchgeführten Aufgaben, mit frühen Bemühungen vieler Pioniere der Informatik, darunter Konrad Zuse 1945, Norbert Wiener in seinem Buch Kybernetik (1948)(1) und Alan Turing 1950 (siehe Turing et al., 1953)(2). Aber es war Claude Shannons Artikel Programming a Computer for Playing Chess (1950)(3), der den vollständigsten Satz von Ideen hatte, der eine Repräsentation für Brettpositionen, eine Bewertungsfunktion, Ruhesuche (quiescence search) und einige Ideen für die selektive (nicht erschöpfende) game-tree search beschrieb. Slater (1950)(4) und die Kommentatoren seines Artikels untersuchten auch die Möglichkeiten des Computerschachspiels. D. G. Prinz (1952)(5) absolvierte ein Programm, das Probleme beim Endspiel im Schach löste, aber kein vollständiges Spiel spielte. Stan Ulam und eine Gruppe des Los Alamos National Lab erstellten ein Programm, das Schach auf einem 6×6 Brett ohne Läufer spielte (Kister et al., 1957)(6). Es konnte 4 Halbzüge (plies) deep in ca. 12 Minuten durchsuchen. Alex Bernstein schrieb das erste dokumentierte Programm, das eine vollständige Standardschachpartie spielte (Bernstein und Roberts, 1958)(7). Das erste Computerschachspiel beinhaltete das Kotok-McCarthy-Programm des MIT (Kotok, 1962)(8) und das ITEP-Programm, das Mitte der 1960er Jahre am Moskauer Institut für theoretische und experimentelle Physik geschrieben wurde (Adelson-Velsky et al., 1970)(9). Das erste Schachprogramm, das erfolgreich mit Menschen konkurrierte, war MACHACK-6 von MIT(Greenblatt et al., 1967)(10). Der Preis in Höhe von 10.000 US-Dollar für das erste Programm, das eine USCF-Bewertung (United States Chess Federation) von 2500 (nahe der Großmeisterstufe) erreichte, wurde 1989 an DEEP THOUGHT (Hsu et al., 1990)(11) vergeben. Der Hauptpreis, 100.000 Dollar, ging an DEEP BLUE (Campbell et al., 2002(12); Hsu, 2004(13)) für seinen bahnbrechenden Sieg über Weltmeister Garry Kasparov in einem Freundschaftsspiel 1997. Norvig I 193 HYDRA (Donninger und Lorenz, 2004(14)) wird zwischen 2850 und 3000 bewertet, was hauptsächlich auf dem Sieg über Michael Adams basiert. Das RYBKA-Programm wird zwischen 2900 und 3100 bewertet, aber dies basiert auf einer kleinen Anzahl von Spielen und gilt nicht als zuverlässig. Ross (2004)(15) zeigt, wie menschliche Spieler gelernt haben, einige der Schwächen der Computerprogramme auszunutzen. >Künstliche Intelligenz, >Maschinenlernen. 1. Wiener, N. (1948). Cybernetics. Wiley. 2. Turing, A., Strachey, C., Bates,M. A., and Bowden, B. V. (1953). Digital computers applied to games. In Bowden, B. V. (Ed.), Faster than Thought, pp. 286 - 310. Pitman. 3. Shannon, C. E. (1950). Programming a computer for playing chess. Philosophical Magazine, 41(4), 256–275 4. Slater, E. (1950). Statistics for the chess computer and the factor of mobility. In Symposium on Information Theory, pp. 150-152. Ministry of Supply 5. Prinz, D. G. (1952). Robot chess. Research, 5, 261- 266. 6. Kister, J., Stein, P., Ulam, S., Walden, W., and Wells, M. (1957). Experiments in chess. JACM, 4, 174–177. 7. Bernstein, A. and Roberts, M. (1958). Computer vs. chess player. Scientific American, 198(6), 96- 105. 8. Kotok, A. (1962). A chess playing program for the IBM 7090. AI project memo 41, MIT Computation Center. 9. Adelson-Velsky, G. M., Arlazarov, V. L., Bitman, A. R., Zhivotovsky, A. A., and Uskov, A. V. (1970). Programming a computer to play chess. Russian Mathematical Surveys, 25, 221-262. 10. Greenblatt, R. D., Eastlake, D. E., and Crocker, S. D. (1967). The Greenblatt chess program. In Proc. Fall Joint Computer Conference, pp. 801-810. 11. Hsu, F.-H., Anantharaman, T. S., Campbell, M. S., and Nowatzyk, A. (1990). A grandmaster chess machine. Scientific American, 263(4), 44–50. 12. Campbell, M. S., Hoane, A. J., and Hsu, F.-H. (2002). Deep Blue. AIJ, 134(1–2), 57–83. 13. Hsu, F.-H. (2004). Behind Deep Blue: Building the Computer that Defeated the World Chess Champion. Princeton University Press. 14. Donninger, C. and Lorenz, U. (2004). The chess monster hydra. In Proc. 14th International Conference on Field-Programmable Logic and applications, pp. 927-932. 15. Ross, P. E. (2004). Psyching out computer chess players. IEEE Spectrum, 41(2), 14-15. |
Russell I B. Russell/A.N. Whitehead Principia Mathematica Frankfurt 1986 Russell II B. Russell Das ABC der Relativitätstheorie Frankfurt 1989 Russell IV B. Russell Probleme der Philosophie Frankfurt 1967 Russell VI B. Russell Die Philosophie des logischen Atomismus In Eigennamen, U. Wolf (Hg) Frankfurt 1993 Russell VII B. Russell On the Nature of Truth and Falsehood, in: B. Russell, The Problems of Philosophy, Oxford 1912 - Dt. "Wahrheit und Falschheit" In Wahrheitstheorien, G. Skirbekk (Hg) Frankfurt 1996 Norvig I Peter Norvig Stuart J. Russell Artificial Intelligence: A Modern Approach Upper Saddle River, NJ 2010 |
Der gesuchte Begriff oder Autor findet sich in folgenden 3 Thesen von Autoren des zentralen Fachgebiets.
| Begriff/ Autor/Ismus |
Autor |
Eintrag |
Literatur |
|---|---|---|---|
| Denken | Black, Max | II 94 Max Black These: Denken ohne Sprache ist möglich - Bsp Sich Schachstellungen vorzustellen. |
|
| Behauptbarkeit | Brandom, R. | II 243 Brandom eigener Ansatz: These regelgeleitetes Sprachspiel, das erlaubt, mit deklarativen Sätzen propositionale Gehalte zu verbinden, die in dem Sinne objektiv sind, daß sie sich von den Einstellungen der Sprecher ablösen - das spaltet die Behauptbarkeit in zwei Teile: Festlegung und Berechtigung (zwei normative Status) - geht über BT hinaus, weil es die Unterscheidung von richtigem und falschem Gebrauch ermöglicht. (>Dummett, >Schach, Witz, Gewinn) |
|
| Fiktion | Lewis, D. | IV 268 Namen/Fiktion/Lewis: wenn eine Welt so ist, daß es dort weder die Geschichten noch einen Menschen Holmes gibt, dann hat er keine Denotation in dieser Welt w. Sogar, wenn der Plot der Geschichten sich dort ereignet. Denn auch in unserer Welt ist "Holmes" denotationslos. Schw I 72 Fiktionalismus/mögliche Welt/MöWe/Lewis/Schwarz: Sätze über Möglichkeiten und MöWe funktionieren wie Sätze über Abwesenheiten, Durchschnittsbürger oder Holmes. D.h. sie können wahr sein, obwohl die Gegenstände nicht existieren. Fiktionalismus: Sätze über MöWe analog zu Sätzen über Holmes: weil Holmes ja selbst ein mögliches Ding sei. (einfache Form: Rosen, 1990, Sider 2002, verschachtelt: Armstrong 1989a, Zwischenformen: Fine 1976, 2003b). These: Sätze der Form: "es gibt eine Welt, in der..." interpretiert als "es ist möglich, daß es eine Welt gibt,.." ((s) Löst die Quantifikation zugunsten von Modaloperatoren auf). |
|