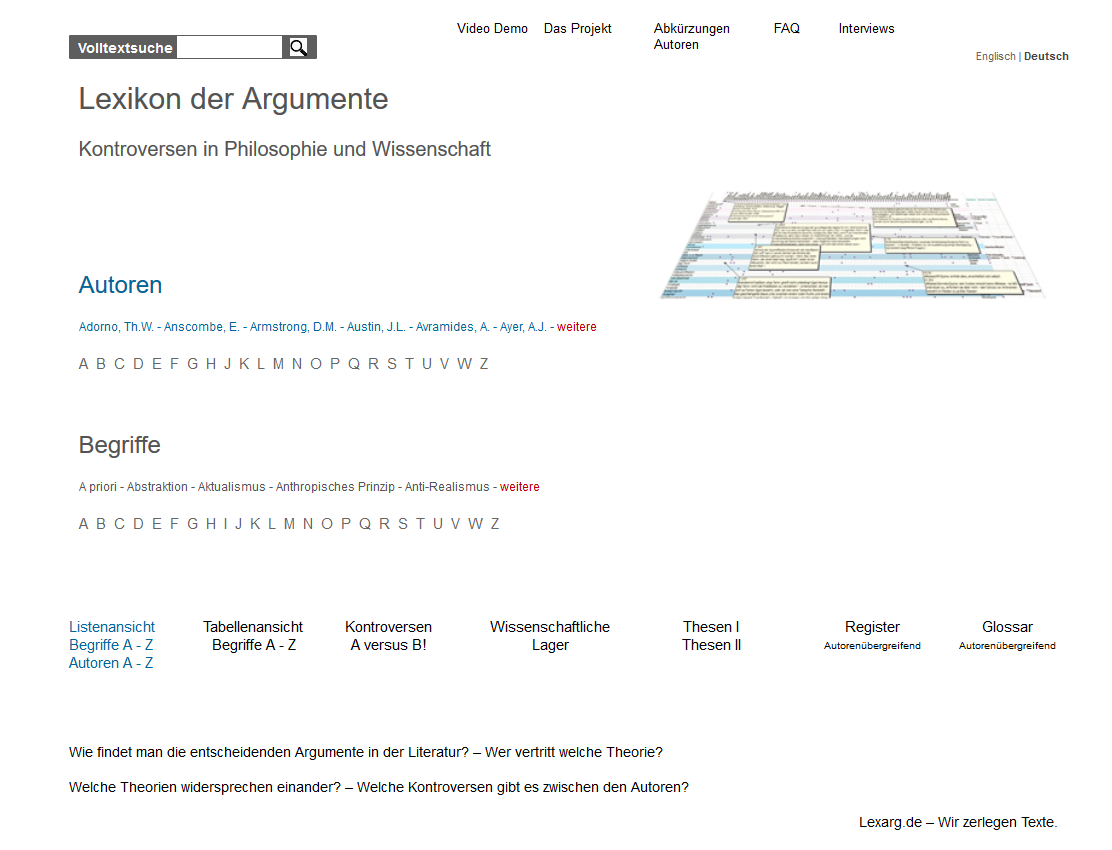Wirtschaft Lexikon der ArgumenteHome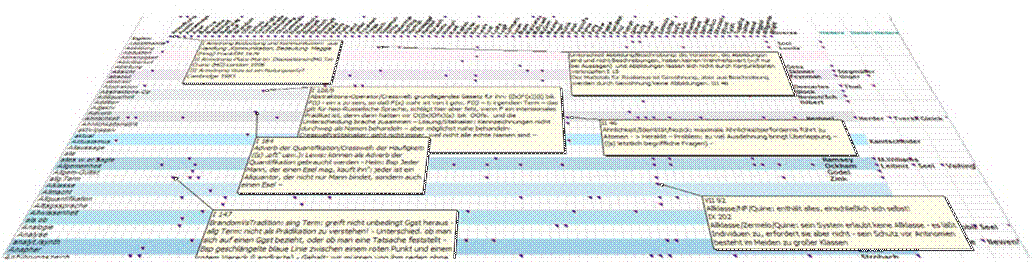
| |||
|
| |||
| Balance of power: Das "Gleichgewicht der Kräfte" bezieht sich auf einen Zustand des Gleichgewichts zwischen konkurrierenden Nationen oder Einheiten, der verhindert, dass eine einzelne Nation andere dominiert. Es umfasst strategische Allianzen, Diplomatie und militärische Fähigkeiten, um Aggressionen zu verhindern und die Stabilität in den internationalen Beziehungen zu wahren. Siehe auch Internationale Beziehungen, Außenpolitik._____________Anmerkung: Die obigen Begriffscharakterisierungen verstehen sich weder als Definitionen noch als erschöpfende Problemdarstellungen. Sie sollen lediglich den Zugang zu den unten angefügten Quellen erleichtern. - Lexikon der Argumente. | |||
| Autor | Begriff | Zusammenfassung/Zitate | Quellen |
|---|---|---|---|
|
Sozialwahltheorie über Balance of Power - Lexikon der Argumente
Gaus I 291 Balance of Power/Politischer Realismus/Sozialwahltheorie/Brown: Die von einem Selbsthilfesystem auferlegten Imperative treiben Staaten dazu an, sich rational und egoistisch zu verhalten: Staaten sind verpflichtet, sich gegenseitig als potenzielle Feinde zu behandeln, auch wenn sich, wenn ein Machtgleichgewicht (Balance of Power) aufrechterhalten werden kann, ein gewisses Maß an Stabilität herausbilden kann. Das Schöne an diesem Ansatz ist, dass durch eine geringfügige Neuformulierung seiner Annahmen auch eine Version des liberalen Internationalismus verteidigt werden kann. Neorealisten argumentieren, dass rationale Egoisten in der Anarchie nicht kooperieren können, während Neoliberale argumentieren, dass bei einem gewissen Grad an Institutionalisierung und verbesserten Informationsflüssen Kooperation möglich ist, wenn auch auf suboptimalen Ebenen (Axelrod und Keohane, 1985(1); Keohane, 1989;(2) Mearsheimer, 2001(3)). >Balance of Power/Walzer. Brown: Der Wechsel vom augustinischen zum "Realismus der rationalen Wahl" hat wichtige Konsequenzen gehabt. (Vgl. >Internationale Beziehungen/Niebuhr). 1) Auf der positiven Seite hat er die Annahme untergraben, dass die Theorie der internationalen Beziehungen in einem starken Sinne sui generis ist, nicht mit den anderen Sozialwissenschaften verbunden ist und auf einer Art Ethnomethodologie der diplomatischen Praxis beruht, zu der die Sozialtheorie im Allgemeinen keinen Beitrag leisten kann. 2) Auf der anderen Seite hat die Dominanz des neorealistischen/neoliberalen Denkens das Spektrum der Fragen, die Theoretiker der internationalen Beziehungen für angemessen oder beantwortbar halten, erheblich eingeengt. Ob Staaten relative oder absolute Gewinne anstreben (eine Möglichkeit, zwischen neorealistischen und neoliberalen Annahmen zu unterscheiden), ist eine interessante Frage, kann aber kaum eine befriedigende Grundlage für eine Untersuchung der Grundlagen der gegenwärtigen internationalen Ordnung bilden (Grieco, 1988)(4). 1. Axelrod, R. and R. O. Keohane (1985) 'Achieving cooperation under anarchy: strategies and institutions'. World Politics, 38: 226-54. 2. Keohane, R. O. (1989) International Institutions and State Power. Boulder, CO: Westview. 3. Mearsheimer, J. (2001) The Tragedy of Great Power Politics. New York: Norton. 4. Grieco, J. M. (1988) 'Anarchy and the limits of cooperation: a realist critique of the newest liberal institutionalism'. International Oganisation, 42:485—508. Brown, Chris 2004. „Political Theory and International Relations“. In: Gaus, Gerald F. & Kukathas, Chandran 2004. Handbook of Political Theory. SAGE Publications_____________ Zeichenerklärung: Römische Ziffern geben die Quelle an, arabische Ziffern die Seitenzahl. Die entsprechenden Titel sind rechts unter Metadaten angegeben. ((s)…): Kommentar des Einsenders. Übersetzungen: Lexikon der ArgumenteDer Hinweis [Begriff/Autor], [Autor1]Vs[Autor2] bzw. [Autor]Vs[Begriff] bzw. "Problem:"/"Lösung", "alt:"/"neu:" und "These:" ist eine Hinzufügung des Lexikons der Argumente. |
Sozialwahltheorie
Gaus I Gerald F. Gaus Chandran Kukathas Handbook of Political Theory London 2004 |
||
> Gegenargumente gegen Sozialwahltheorie
> Gegenargumente zu Balance of Power