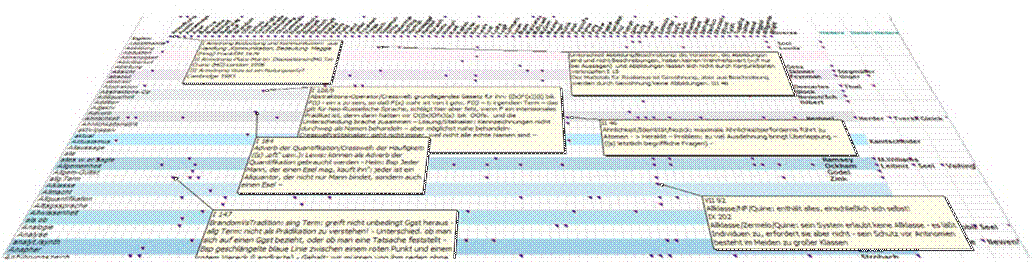Finden Sie Gegenargumente, in dem Sie NameVs…. oder….VsName eingeben.
Der gesuchte Begriff oder Autor findet sich in folgenden 3 Einträgen:
| Begriff/ Autor/Ismus |
Autor |
Eintrag |
Literatur |
|---|---|---|---|
| Soziale Welt | Bruner | Haslam I 238 Soziale Welt/Information/Stereotypen/Komplexität/Bruner: These: (Bruner 1957)(1): BrunerVsTradition: Sozial Wahrnehmende werden nicht durch zu viele Informationen über die soziale Welt, sondern durch zu wenige behindert. Tradition: Walter Lippmann (1922)(2), aber auch (...) William James (...) schrieben bekanntlich über die Welt als "blühende, summende Verwirrung" (James, 1890(3): 488), viele Psychologen glauben, dass sozial Wahrnehmende durch eine konfrontierend komplexe Welt herausgefordert werden und dass sie deshalb einen Teil dieser Verwirrung ausblenden müssen (auch auf die Gefahr hin, sie zu vereinfachen). >Vereinfachung/psychologische Theorien, >W. James, >W. Lippmann. McGartyVsTradition: Sozial Wahrnehmende versuchen stattdessen, ihren Wissensschatz zu erweitern; (...) sie suchen nach Feinheiten und verborgenen Einsichten. >Illusorische Korrelation/McGarty. 1. Bruner, J.S. (1957) ‘On perceptual readiness’, Psychological Review, 64: 123–52. 2. Lippmann, W. (1922) Public Opinion. New York: Harcourt Brace. 3. James, W. (1890) Principles of Psychology. New York: Henry Holt & Co. Craig McGarty, „Stereotype Formation. Revisiting Hamilton and Gifford’s illusory correlation studies“, in: Joanne R. Smith and S. Alexander Haslam (eds.) 2017. Social Psychology. Revisiting the Classic studies. London: Sage Publications |
Haslam I S. Alexander Haslam Joanne R. Smith Social Psychology. Revisiting the Classic Studies London 2017 |
| Soziale Welt | James | Haslam I 238 Soziale Welt/James: William James (...) schrieb bekanntlich über die Welt als "blühende, summende Verwirrung" (James, 1890(1): 488), viele Psychologen glauben, dass sozial Wahrnehmende durch eine konfrontierend komplexe Welt herausgefordert werden und dass sie deshalb einen Teil dieser Verwirrung ausblenden müssen (auch auf die Gefahr hin, sie zu vereinfachen). >Vereinfachung/psychologische Theorien. Siehe auch Walter Lippman (1922)(2). McGartyVsTradition: Sozial Wahrnehmende versuchen stattdessen, ihren Wissensbestand zu erweitern; (...) Haslam I 239 sie suchen nach Feinheiten und verborgenen Einsichten. >Illusorische Korrelation/McGarty. 1. James, W. (1890) Principles of Psychology. New York: Henry Holt & Co. 2. Lippmann, W. (1922) Public Opinion. New York: Harcourt Brace. Craig McGarty, „Stereotype Formation. Revisiting Hamilton and Gifford’s illusory correlation studies“, in: Joanne R. Smith and S. Alexander Haslam (eds.) 2017. Social Psychology. Revisiting the Classic studies. London: Sage Publications |
Haslam I S. Alexander Haslam Joanne R. Smith Social Psychology. Revisiting the Classic Studies London 2017 |
| Soziale Welt | McGarty | Haslam I 239 Soziale Welt / Stereotypen / McGarty: Unser Ansatz (McGarty et al. (1993)(1) wurde durch einen alternativen sozial-kognitiven Ansatz zur Stereotypisierung geprägt, der vom Ansatz der sozialen Identität und insbesondere der Theorie der Selbstkategorisierungs inspiriert wurde (Turner et al., 1994)(2). Siehe auch >Soziale Welt/James, >Soziale Welt/Brunner). McGartyVsBruner, McGartyVsJames. These: Sozial Wahrnehmende sind nicht mit einer zu komplexen Welt konfrontiert, die sie übermäßig vereinfachen müssen, sondern versuchen, ihren Wissensschatz zu erweitern; sie suchen nach Feinheiten und verborgenen Einsichten. Stereotypen/McGartyVsTradition/McGarty: These: Stereotypen sind keine starren, vereinfachenden und negativen Verzerrungen der Realität, sondern tatsächlich Eindrücke von Gruppen, die dazu neigen würden, so flexibel, komplex, positiv und genau zu sein, wie sie es sein müssen, um das Bedürfnis der Wahrnehmenden widerzuspiegeln, welche sie gebildet haben, um sich an die Umgebung, mit der sie sich konfrontiert sehen, anzupassen und mit ihr zu interagieren. 1. McGarty, C., Haslam, S.A., Turner, J.C. and Oakes, P.J. (1993) ‘Illusory correlation as accentuation of actual intercategory difference: Evidence for the effect with minimal stimulus information’, European Journal of Social Psychology, 23: 391–410. 2. Turner, J.C., Oakes, P.J., Haslam, S.A. and McGarty, C. (1994) ‘Self and collective: Cognition and social context’, Personality and Social Psychology Bulletin, 20: 454–63. Craig McGarty, „Stereotype Formation. Revisiting Hamilton and Gifford’s illusory correlation studies“, in: Joanne R. Smith and S. Alexander Haslam (eds.) 2017. Social Psychology. Revisiting the Classic studies. London: Sage Publications |
Haslam I S. Alexander Haslam Joanne R. Smith Social Psychology. Revisiting the Classic Studies London 2017 |