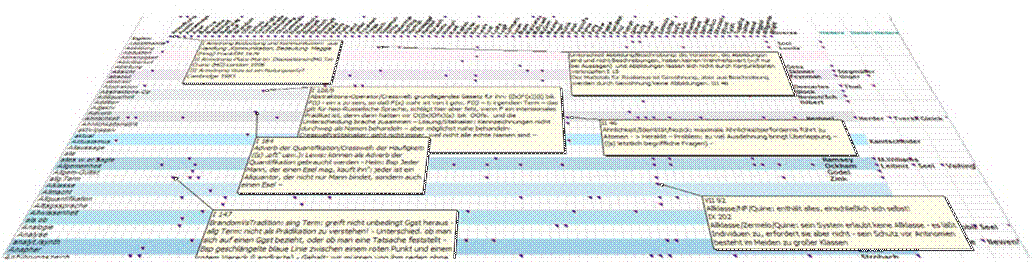Finden Sie Gegenargumente, in dem Sie NameVs…. oder….VsName eingeben.
| Begriff/ Autor/Ismus |
Autor Vs Autor |
Eintrag |
Literatur |
|---|---|---|---|
| Gewinn Spiel | Boer Vs Castaneda, H.-N. | Frank I 387 Castaneda: These: sowohl die singuläre indexikalische Bezugnahme der ersten Person als auch die ihr entsprechende quasi indexikalische Referenz ist begrifflich irreduzibel. Boer/LycanVsCastaneda: I 388 (1) Armand glaubt, dass er (selbst) glücklich ist (1.A) [Die triadische Relation] GLAUBT verbindet Armand, eine leere Objektfolge und [das demonstrative] DASS > [was auf einen Satztyp verweist, der in jeder Sprache dieselbe allgemeine Verhaltensrolle hat wie unser Satz] "Ich bin glücklich". Pfeil: Zeigehandlung des Sprechers in eckigen Klammern: Kommentar des Analytikers in bezug auf die folgenden Ausdrücke. DASS: setzt Davidsons Theorie der indirekten Rede um: es zeigt auf einen Satz, den der Sprecher hervorbringt, der bloß phonetisch oder graphisch neben das psychologische Verb gestellt ist. Rolle des Satzes: (nach Sellars): in Def "Punkt Anführungszeichen": das signalisiert die Rolle, die Tokens dieses Typs in der Verhaltensökonomie des Sprechers Spielen: Bsp "red" (in Punkt-Anführungszeichen) bezeichnet dieselbe Rolle wie ein in Punkt-Anführungszeichen gesetztes "rouge". Das ist ein ErkenntnisGewinn. ((s) Sprachunabhängig! anders als bei Tarski). das ist eine nominalistische Analyse von "er selbst". (>Nominalismus). Castaneda: Frage: 1. (diagonales Argument aus 3. I 337): Propositionen haben Wahrheitswerte, Problem: gibt es ausreichend Propositionen um unendliche Eigenschaften zu beschreiben?) 2. Realismus: fragt: wie könne Objekte und Fälle von Verhalten voneinander unterschieden werden, ohne dass Qualitäten oder Relationen Klassifikationskriterien und Rollenmerkmale liefern? Hector-Neri Castaneda (1987b): Self-Consciousness, Demonstrative Reference, and the Self-Ascription View of Believing, in: James E. Tomberlin (ed) (1987a): Critical Review of Myles Brand's "Intending and Acting", in: Nous 21 (1987), 45-55 James E. Tomberlin (ed.) (1986): Hector-Neri.Castaneda, (Profiles: An International Series on Contemporary Philosophers and Logicians, Vol. 6), Dordrecht 1986 |
Boer I Steven E. Boer Thought-Contents: On the Ontology of Belief and the Semantics of Belief Attribution (Philosophical Studies Series) New York 2010 Boer II Steven E. Boer Knowing Who Cambridge 1986 Fra I M. Frank (Hrsg.) Analytische Theorien des Selbstbewusstseins Frankfurt 1994 |
| Gewinn Spiel | Simons Vs Chisholm, R.M. | Chisholm II 166 SimonsVsChisholm/SimonsVsBrentano: These: Chisholm hat von Brentano einen mereologischen Essentialismus geerbt, mit dem ich nicht übereinstimme. Ich werde aber diese Ideen benutzen, um eine leicht abweichende Interpretation von Wittgensteins Tractatus zu geben. Wittgenstein selbst war nicht so klar in Bezug auf Tatsachen wie es scheint. Selbstkritik: Es gibt ein Durcheinander von Tatsachen und Komplexen. Zwischen dem späteren Wittgenstein und Brentano liegen Welten, aber es gibt Berührungen zwischen Brentano und dem Tractatus. --- Simons I 1 Extensionale Mereologie/Simons: Extensionale Mereologie ist die klassische Theorie. Schreibweise: CEM. Individuenkalkül/Leonard/Goodman: (40er Jahre): Das "Individuenkalkül" ist ein anderer Name für die CEM. Das soll zum Ausdruck bringen, dass die Gegenstände der Teil-Ganzes-Relation zum niedrigsten logischen Typ gehören (und alles Individuen sind - sowohl ein Ganzes als auch ein Teil sind Individuen). VsCEM: 1. CEM Behauptet die Existenz von Summen als Individuen, für deren Existenz wir außerhalb der Theorie keinerlei Hinweise haben. 2. Die ganze Theorie ist für die meisten Dinge in unserem Leben gar nicht anwendbar. 3. Die Logik der CEM hat nicht die Ressourcen, mit temporalen und modalen Begriffen umzugehen: Bsp zeitlicher Teil, wesentlicher Teil usw. Simons: Das sind alles externe Kritiken, es gibt aber eine interne Kritik, welche aus der extensionalen Mereologie erwächst. These: Objekte mit denselben Teilen sind identisch (analog zur Mengenlehre). Problem: 1. Flux: Bsp Menschen haben verschiedene Teile zu verschiedenen Zeiten. I 2 2. Modalität/extensionale Mereologie: Problem: Bsp Ein Mensch könnte andere Teile haben, als er aktual hat und dennoch derselbe Mensch sein. (s) Die Extensionalität würde dann zusammen mit der Leibniz‘schen Identität verlangen, dass alle Teile wesentlich sind. Das führt zum mereologischen Essentialismus. Chisholm/Mereologischer Essentialismus/Simons: Chisholm vertritt den mereologischen Essentialismus: These: Kein Objekt kann andere Teile haben, als es aktual hat. Vs: Problem: Es ist problematisch zu erklären, wieso normale Gegenstände nicht modal starr (alle Teile wesentlich) sind. Lösung/Chisholm: These: (erscheinende) Dinge (Engl. "appearances", alltägliche Dinge) sind logische Konstruktionen aus Objekten, für die der mereologische Essentialismus gilt. Flux/Mereologie/Simons: Problem/(s): Sich verändernde Objekte dürfen nach der CEM nicht als mit sich identisch angesehen werden. 1. Lösung/Chisholm: These: Die tatsächlichen Objekte sind mereologisch konstant und die Erscheinungen wieder logische Konstruktionen aus unveränderlichen Objekten. SimonsVsChisholm: Der Preis ist zu hoch. 2. Verbreitete Lösung: Eine Lösung besteht in der Ersetzung der normalen Dinge (continuants) durch Prozesse, die ihrerseits zeitliche Teile haben. SimonsVs: Damit kann die Extensionalität nicht aufrechterhalten werden. Solche vierdimensionalen Objekte scheitern am modalen Argument. CEM/Ereignis/Simons: Im Fall von Ereignissen ist die extensionale Mereologie angebracht. Auch bei: Klassen/Massen/Simons: Das sind nicht-singuläre Objekte, für die die Extensionalität gilt. Teil/Simons: Ein Teil ist mehrdeutig, je nachdem ob im Zusammenhang mit Individuen, Klassen oder Massen gebraucht. Extensionalität/Mereologie/Simons: Wenn Extensionalität zurückgewiesen wird, haben wir es mit continuants zu tun. I 3 Continuants/Simons: Continuants können im Flux sein. Extensionalität/Simons: Wenn wir Extensionalität zurückweisen, kann mehr als ein Objekt exakt dieselben Teile haben und daher auch mehrere verschiedene Objekte zur selben Zeit am selben Ort sein. I 175 Zeitlicher Teil/continuants/Mereologie/SimonsVsAlle/SimonsVsChisholm: These: Auch continuants können zeitliche Teile haben! D.h. sie sind nicht mereologisch konstant, sondern mereologisch variabel. Continuants/Simons: These: Continuants müssen auch nicht ununterbrochen existieren. Das liefert uns eine überraschende Lösung für das Problem des Schiffs des Theseus. I 187 SimonsVsChisholm: Wenn Chisholm Recht hat, sind die meisten alltäglichen Dinge, einschließlich unseres Organismus, nur logische Konstruktionen. I 188 Strikte Verbindung/Getrenntheit/SimonsVsChisholm: Das Kriterium für strikte Verbindung ist unglücklicherweise so, dass es impliziert, dass wenn x und y strikt verbunden sind, aber nicht in Kontakt stehen, sie dadurch getrennt werden können, dass ein drittes Objekt zwischen ihnen vorbeigeht, was nicht per se ein Wandel ist, auch nicht in ihren direkten Relationen zu einander. Problem: Wenn dieses Vorbeigehen nur sehr kurz ist, ist die Frage, ob die getrennte Summe der beiden, die durch das dritte Objekt ausgelöscht wurde, dieselbe ist, die wieder in die Existenz tritt, wenn das dritte Objekt verschwunden ist. Wenn es dieselbe ist, haben wir eine unterbrochen existierende Summe. Chisholm: Er selbst stellt sich diese Frage an dem Bsp: eine Burg aus Spielzeugsteinen wird abgerissen und aus denselben Steinen wieder aufgebaut. I 189 Chisholm: These: Es ist ein Grund, mit der normalen Ontologie unzufrieden zu sein, weil sie gerade solche Beispiele ermöglich. SimonsVsChisholm: Aber Chisholms eigene Begriffe haben uns gerade das vorige BeiSpiel ermöglicht. Topologie/Simons: Dennoch gibt es keinen Zweifel, dass es sinnvoll ist, topologische Begriffe wie Berühren oder im Innern von etwas sein, zur Mereologie hinzuzufügen. I 192 Def Sukzession/Chisholm: 1. x ist ein direkter a-Nachfolger von y zu t’ = Def (i) t beginnt nicht vor t’ (ii) x ist ein a zu t und y ist ein y zu t’ (iii) es gibt ein z sodass z ein Teil von x zu t ist und ein Teil von y zu t’ und in jedem Moment zwischen t’ und t einschließlich, ist z selbst ein a. Simons: Dabei wird es im Allgemeinen mehrere solche Teile geben. Wir wählen immer den größten. w: w sei dabei der gemeinsame Teil, Bsp bei der Veränderung eines Tisches. SimonsVsChisholm: Problem: w ist nicht immer ein Tisch! ChisholmVsVs: Chisholm behauptet, dass w sehr wohl ein Tisch sei: Wenn wir einen kleinen Teil des Tischs wegschneiden bleibt immer noch ein Tisch über. Problem: Aber wenn das Ding, das übrigbleibt, ein Tisch ist, weil es schon vorher dort war, dann war es ein Tisch, der ein echter Teil eines Tisches war! I 193 SimonsVsChisholm: Das Argument ist nicht gültig! Bsp Shakespeare, Heinrich IV., Akt IV Szene V: Prinz Hal überlegt: Wenn der König stirbt, werden wir immer noch einen König haben, (nämlich mich selbst, den Erben). Aber wenn diese Person ein König ist, dann, weil er früher schon da war, dann war er ein König, der der älteste Sohn eines Königs war ((s) Widerspruch, weil dann zwei Könige gleichzeitig hätten da sein müssen). Simons: Dieser Punkt ist nicht neu und wurde schon von Wiggins und Quine (nicht VsChisholm) hervorgehoben. I 194 Veränderung/Wandel/Teil/Sukzession/SimonsVsChisholm: Es scheint, dass sie aber nicht kompatibel sind mit dem einfachen Fall, wo a gleichzeitig Teile gewinnt und verliert. Bsp Dann sollte a+b ein A-Vorgänger von a+c und a+c ein A-Nachfolger von a+b sein. Aber das wird durch die Definitionen nicht erlaubt, außer wenn wir wissen, dass a die ganze Zeit ein A ist, sodass es a+b und a+c in einer Kette verbindet. Aber das wird meist nicht der Fall sein. Und wenn es nicht der Fall ist, wird a überhaupt nie ein A sein! SimonsVsChisholm: Chisholms Definitionen funktionieren also nur, wenn er ein falsches Prinzip annimmt! Sukzession/entia sukzessiva/SimonsVsChisholm: Problem: Dass jedes der Dinge die “einstehen” sollen (für ein konstantes ens per se, um den Wandel zu erklären) selbst ein a im ursprünglichen Sinn sein soll (Bsp Tisch, Katze usw.) ist kontraintuitiv. Lösung/Simons: Das "ist" ist hier ein "ist" der Prädikation und nicht der Konstitution (>Wiggins 1980, 30ff). Mereologische Konstanz/Simons: These: Die meisten Dinge, von den wir Sachen prädizieren wie Bsp "ist ein Mensch" oder "ist ein Tisch" sind mereologisch konstant. Der Rest ist einfach lockere Redeweise und ein Spielen mit Identität. Bsp Wenn wir sagen, dass der Mann vor uns im letzten Jahr eine Menge Haare verloren hat, gebrauchen wir "Mann" sehr locker. Chisholm: Wir sollten strenggenommen sagen, dass der Mann, der heute für (stehen für) denselben sukzessiven Mann einsteht, weniger Haare hat als der Mann, der letztes Jahr für ihn einstand. SimonsVsChisholm/WigginsVsChisholm: Damit ist er gefährlich nahe am Vierdimensionalismus. Und zwar besonders wegen folgender These: I 195 Einstehen für/stehen für/entia sukzessiva/Chisholm: These: Das ist keine Relation eines Aggregats zu seinen Teilen. Sortalbegriff/Simons: Die Frage ist, ob Sortalbegriffe, die an die Bedingungen geknüpft sind, die festlegen, was zu einer Zeit oder über die Zeit als ein Ding oder als mehrere Dinge einer Art zählen soll, eher auf mereologisch konstante Objekte (Chisholm) oder auf variable Objekte (Simons, Wiggins) anwendbar sind. SimonsVsChisholm: Seine These hat zur Folge dass die meisten Menschen meist ihre meisten Begriffe falsch gebrauchen, wenn das dann nicht überhaupt immer der Fall ist. I 208 Person/Körper/unterbrochene Existenz/Identität/Mereologie/Chisholm/Simons: Unsere Theorie ist am Ende gar nicht so verschieden von der von Chisholm, außer dass wir nicht Materie-Konstanz als „streng und philosophisch“ annehmen und diese einem alltagssprachlichen Gebrauch von Konstanz gegenüberstellen. SimonsVsChisholm: Vorteil: Wir können zeigen, wie der aktuale Gebrauch von „Schiff“ mit versteckten Tendenzen zusammenhängt, ihn im Sinne von „materie-konstantes Schiff“ zu gebrauchen. Schiff des Theseus/SimonsVsChisholm: Wir sind nicht zu mereologischem Essentialismus verpflichtet. Ein materie-konstantes Schiff ist letztlich ein Schiff! D.h. es ist gebrauchsfähig! Unterbrochene Existenz/Substrat/Simons: Es muss ein Substrat geben, das die Identifikation über die Lücke hinweg erlaubt. I 274 SimonsVsChisholm: Nach Chisholms Prinzip gibt es gar kein echtes Objekt, das ein Tisch ist, denn dieser kann ständig seine Mikrostruktur ändern ((s) Atome gewinnen oder verlieren). Chisholm/Simons: Damit ist Chisholm aber nicht der geringste Widerspruch nachgewiesen. |
Simons I P. Simons Parts. A Study in Ontology Oxford New York 1987 Chisholm I R. Chisholm Die erste Person Frankfurt 1992 Chisholm II Roderick Chisholm In Philosophische Aufsäze zu Ehren von Roderick M. Ch, Marian David/Leopold Stubenberg Amsterdam 1986 Chisholm III Roderick M. Chisholm Erkenntnistheorie Graz 2004 |
| Gewinn Spiel | Hintikka Vs Cresswell, M.J. | Cresswell I 158 Spieltheoretische Semantik/GTS/Spieltheorie/Hintikka/Terminologie/Cresswell: ist für meine Zwecke eigentlich nicht wichtig. I 159 HintikkaVsCresswell: Vs Gebrauch von Entitäten höherer Stufe. ((s) Statt Logik 2. Stufe und statt verzweigter Quantoren, um Kompositionalität wieder herzustellen). (Hintikka 1983, 281-285). CresswellVsHintikka/CresswellVsSpieltheoretische Semantik: 1. sie quantifiziert selbst über Entitäten höherer Stufe, nämlich Strategien! Insbesondere in den WB für Sätze wie (28), trotz Hintikkas Behauptung, verzweigte Quantoren würden Individuen nur erwähnen. (s. 282). CresswellVsHintikka: 2. Def Wahrheit/Spieltheoretische Semantik/Hintikka: besteht in der Existenz einer Gewinnstrategie. Wenn wir nun (x)(Ey)Fxy als Ef(x)Fxf(x) formalisieren, sind wir gar nicht in einen Spielzug involviert! Spielzug/Spieltheorie/Hintikka/Cresswell: besteht in einer einzelnen bestimmten Wahl der Natur für x und dann einer bestimmten Wahl durch mich. Satzbedeutung/CresswellVsHintikka: Pointe: dann kann ein einzelnes Spiel die Satzbedeutung definieren, und nicht repräsentieren, wie der Sprecher damit umgeht bzw. seine Bedeutung repräsentiert. Hintikka II 63 logische Allwissenheit/Semantik möglicher Welten/MöWe-Semantik/Hintikka: das Problem tritt hier gar nicht auf! Bsp (1) Ein Satz der Form „a weiß dass p“ ist wahr in einer möglichen Welt (MöWe) W gdw. p wahr ist in allen a-Alternativen. D.h. in allen Möwe, die mit dem Wissen von a kompatibel sind. logische Allwissenheit: ihr Fehlschlagen kann so formuliert werden: (2) Es gibt a, p und q so dass a weiß dass p, p impliziert logisch q ,aber a weiß nicht, dass q. logische Wahrheit: wird dann modell-theoretisch analysiert: (3) Ein Satz ist logisch wahr, gdw. er wahr in jeder logisch möglichen Welt. Problem: (1) – (3) sind inkompatibel! Allerdings sind sie in der oben gegebenen Form noch nicht inkompatibel, sondern nur mit der zusätzlichen Annahme: (4) Jede epistemisch mögliche Welt ist logisch möglich. II 64 Problem: jetzt kann es sein, dass in einer epistemischen a-Alternative W’ q falsch ist! Problem: nach (4) sind diese epistemischen Welten auch logisch möglich. Nach der logischen Wahrheit von (p > q) ((s) in diesem BeiSpiel) muss aber q in jeder logisch möglichen Welt wahr sein. Daraus entsteht der Widerspruch. Lösung: verschiedene Autoren haben verschieden darauf reagiert: Positivismus: nimmt Zuflucht zum nichtinformativen (tautologischen) logischer Wahrheit. HintikkaVs: statt dessen. Möwe-Semantik. (4): setzt die Allwissenheit schon voraus! Es setzt voraus, dass a nur scheinbare Möglichkeiten schon eliminieren kann. Das ist zirkulär. Lösung: es kann Möglichkeiten geben, die nur möglich erscheinen, aber versteckte Widersprüche enthalten. II 65 Problem: das Problem ist hier also (4) und nicht (2)! Lösung/Hintikka: wir müssen Möwe zulassen, die logisch unmöglich sind, aber dennoch epistemisch möglich ((s) anders als die UnMöWe, die bei Stalnaker und Cresswell diskutiert werden. Dann können (1) – (3) zusammen wahr sein. D.h. un einer epistemischen MöWe kann (p > q) fehlschlagen. Unmögliche Welt/UnMöWe/Hintikka: Problem: wie wir sie zulassen können. UnMöWe/Cresswell/Hintikka: schlägt eine Uminterpretation der logischen Konstanten vor. (modelltheoretisch). HintikkaVsCresswell: das eigentliche Problem bei der Allwissenheit ist doch, dass Leute nicht alle logischen Konsequenzen ihres Wissens erkennen. Und das Spielt sich in klassischer Logik ab. Nicht-Standard-Logik: geht an dem Problem vorbei. Man könnte sagen, sie zerstört das Problem statt es zu lösen. |
Hintikka I Jaakko Hintikka Merrill B. Hintikka Untersuchungen zu Wittgenstein Frankfurt 1996 Hintikka II Jaakko Hintikka Merrill B. Hintikka The Logic of Epistemology and the Epistemology of Logic Dordrecht 1989 Cr I M. J. Cresswell Semantical Essays (Possible worlds and their rivals) Dordrecht Boston 1988 Cr II M. J. Cresswell Structured Meanings Cambridge Mass. 1984 |
| Gewinn Spiel | Searle Vs Dennett, D. | Dennett I 558 Intentionalität/SearleVsDennett: ist nicht durch die Zusammensetzung von Apparaten oder den immer besseren Aufbau von Algorithmen zu erreichen. DennettVsSearle: das ist der Glaube an Himmelshaken: der Geist soll nicht entstanden sein, er ist nicht gestaltet, sondern nur (unerklärliche) Quelle von Gestaltung. SearleVsDennett: die Ansicht, man könne nach den "freischwebenden Gründen" für einen Selektionsprozeß für den Geist suchen, sei ein Zerrbild des darwinistischen Denkens. Searle I 179 Wir können den Begriff von einem unbewussten Geisteszustand nur so verstehen, dass er von einem wirklichen Inhalt des Bewusstsein handelte. Def "Verbindungsprinzip": die Idee, dass alle unbewussten intentionalen Zustände im Prinzip Bewusstsein zugänglich sind. 1. SearleVsDennett: es gibt einen Unterschied zwischen intrinsischer Intentionalität und Als ob Intentionalität. Wollte man diesen Unterschied aufgeben, müsste man in Kauf nehmen, dass alles zu etwas Geistigem wird, denn relativ zu irgend einem Zweck lässt sich alles und jedes so behandeln, als ob es etwas geistiges wäre. Bsp Fließendes Wasser ließe sich so beschreiben, als ob es Intentionalität hätte: es versucht, nach unten zu gelangen, indem es cleverer Weise die Linie des geringsten Widerstands besucht, es verarbeitet Information, des berechnet die Größe von Felsen usw.. (> Naturgesetze). Doch wenn Wasser etwas Geistiges ist, dann ist alles etwas Geistiges. 2. Unbewusste intentionale Zustände sind intrinsisch. I 180 3. intrinsische intentionale Zustände, bewusst oder unbewusste, haben immer eine Aspektgestalt. Jemand mag ein Glas Wasser trinken wollen, ohne ein Glas H2O trinken zu wollen. Es gibt unbestimmt viele wahre Beschreibungen des Abendsterns oder eines Glases Wasser, aber wenn jemand ein Glas Wasser wünscht, dann geschieht dies nur unter gewissen Aspekten und unter keinen anderen. I 181 4. Das Aspekte Merkmal lässt sich allein mit Hilfe von Dritte Person Prädikaten nicht erschöpfend oder vollständig charakterisieren. Es wird immer eine Folgerungslücke klaffen zwischen den erkenntnistheoretische Gründen, die wir aus dem Verhalten dafür gewinnen können, dass der Aspekt vorliegt, und der Ontologie des Aspekts selbst. Eine Person mag sehr wohl ein Verhalten des Wassersuchens an den Tag legen, aber jedes solche Verhalten wird auch ein Suchen von H2O sein. Es gibt keine Möglichkeit das Zweite auszuschließen. I 182 Bsp Angenommen, wir hätten ein Hirn o Skop um in den Schädel einer Person zu blicken, und sehen, dass sie Wasser, aber kein H2O will, dann müsste immer noch eine Schlussfolgerung im Spiel sein! Wir müssten dann immer noch eine gesetzesartige Verknüpfung haben, die uns in die Lage versetzt, aus unseren Beobachtungen der neuralen Architektur zu schließen, dass in diesem Fall der Wunsch nach Wasser, nicht aber der Wunsch nach H2O realisiert ist. Die neurophysiologischen Tatsachen sind immer für eine beliebige Menge geistiger Tatsachen kausal hinreichend. 5. Doch die Ontologie der unbewussten Geisteszustände besteht einzig und allein in der Existenz rein neurophysiologischer Phänomene. Bsp stellen wir uns vor, jemand schläft fest und traumlos. Nun ist es so, dass er glaubt, dass die Hauptstadt von Colorado Denver ist. Nun, die einzigen Tatsachen, die existieren können, während er völlig ohne Bewusstsein ist, sind neurophysiologische Tatsachen. I 183 Das scheint ein Widerspruch zu sein: die Ontologie der unbewussten Intentionalität besteht ganz und gar aus objektiven, neurophysiologischen Dritte Person Phänomenen, und dennoch haben diese Zustände eine Aspektgestalt. Dieser Widerspruch löst sich auf, wenn wir folgendes berücksichtigen: 6. Der Begriff eines unbewussten intentionalen Zustands ist der Begriff von einem Zustand, der ein möglicher bewusster Gedanke ist. 7. Die Ontologie des Unbewussten besteht in objektiven Merkmalen des Gehirns, die fähig sind, subjektive bewussten Gedanken zu verursachen. I 184 Die Existenz von Kausalmerkmalen ist damit verträglich, dass ihre Kausalkräfte in jedem Einzelfall durch Störfaktoren blockiert sein mögen. Ein unbewusster intentionaler Zustand mag so beschaffen sein, dass er von der betreffenden Person einfach nicht zum Bewusstsein gebracht wären werden könnte. Er muss jedoch ein Ding von der Art sein, das prinzipiell zum Bewusstsein gebracht werden kann. Mentalismus: der naive Mentalismus führt zu einer Art dispositionalen Analyse unbewusster Geistesphänomene. Die Idee einer dispositionalen Theorie des Geistes ist genau zu dem Zweck eingeführt worden, die Berufung auf das Bewusstsein loszuwerden. (> Dispositionen/Ryle). III 156 Regel/VsSearle: man könnte einwenden: "ist es nicht eigentlich einfach so, "als ob" wir den Regeln folgten?" Als ob/Intentionalität/Searle: "Als ob-Intentionalität" erklärt nichts, wenn es keine wirkliche Intentionalität gibt. Sie hat keine kausale Kraft. SearleVsDennett: sie ist so leer wie dessen "intentionale Haltung". |
Searle I John R. Searle Die Wiederentdeckung des Geistes Frankfurt 1996 Searle II John R. Searle Intentionalität Frankfurt 1991 Searle III John R. Searle Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit Hamburg 1997 Searle IV John R. Searle Ausdruck und Bedeutung Frankfurt 1982 Searle V John R. Searle Sprechakte Frankfurt 1983 Searle VII John R. Searle Behauptungen und Abweichungen In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Searle VIII John R. Searle Chomskys Revolution in der Linguistik In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Searle IX John R. Searle "Animal Minds", in: Midwest Studies in Philosophy 19 (1994) pp. 206-219 In Der Geist der Tiere, D Perler/M. Wild Frankfurt/M. 2005 Dennett I D. Dennett Darwins gefährliches Erbe Hamburg 1997 Dennett II D. Dennett Spielarten des Geistes Gütersloh 1999 Dennett III Daniel Dennett "COG: Steps towards consciousness in robots" In Bewusstein, Thomas Metzinger Paderborn/München/Wien/Zürich 1996 Dennett IV Daniel Dennett "Animal Consciousness. What Matters and Why?", in: D. C. Dennett, Brainchildren. Essays on Designing Minds, Cambridge/MA 1998, pp. 337-350 In Der Geist der Tiere, D Perler/M. Wild Frankfurt/M. 2005 |
| Gewinn Spiel | Gettier Vs Dretske, Fred | Brendel I 204 Def Information/Dretske/Brendel: kein quantitatives Maß, das die beim Empfänger beseitigte Unbestimmtheit angibt, sondern das Rohmaterial, aus dem Bedeutungen entstehen. I 205 Sie ist eine objektive Ware, deren Schaffung, Übertragung und Rezeption keine Interpretation voraussetzt oder erfordert. Signal/Dretske: Bsp Dinge, Sachverhalte, Ereignisse, Zeichen, Nachrichten usw. sie tragen Informationen. Kognitiv Handelnde können aus ihnen Wissen Gewinnen. Informationsgehalt/Dretske: es geht darum, den IG dieser Signale zu bestimmen. Def Information/Informationsgehalt/Dretske/Brendel: ein Signal r trägt die Information, dass s F ist, = die konditionale Wahrscheinlichkeit (Wschk) von s, F zu sein, gegeben r (und k) ist 1 (aber gegeben k allein, weniger als 1). (Dretske 1981a, 65). k: ist das, was der Empfänger schon weiß. Information/Dretske/Brendel: These: ist vorsprachlich, Bsp ein Verkehrszeichen. Keine Aussage. Problem: das kann so nicht in eine logische Form eingefügt werden. Dretske: Z „Am Anfang war Information. Das Wort kam später“. I 206 Wschk/Dretske/Brendel: soll die subjektive Komponente einführen, dass ein und dasselbe Ding für Subjekte mit verschiedenem Vorwissen verschiedene Informationen übermitteln kann. Wschk/Dretske/Brendel: er kann keine subjektive Wschk meinen, denn dann verliert der Informationsbegriff völlig seinen objektiven Charakter. objektive Wschk/Brendel: ist aber relative Häufigkeit (relH) bzw. deren Grenzwert, der Limes der relH von F in G. Problem: auch das kann von Dretske nicht intendiert sein, weil wenn die Bezugsklasse G unendlich ist, so ist der Grenzwert eine Schätzung, da man nur endlich viele Beobachtungen machen kann. Dann könnte eine Wschk von 1 erhalten werden, ohne dass dies dem tatsächlichen Grenzwert entspricht. Wschk/Dretske: eine solche lehnt er daher explizit ab. I 207 Lösung/Dretske: Wschk als relH zwischen Bedingungstypen. 1. es muss kein endliches BeiSpiel sein, dass die aktuale Wschk reflektiert. 2. die Relation, von der die Kommunikation von Inhalten abhängt, ist die gesetzmäßige Abhängigkeit einer Bedingung von einer anderen. DretskeVsCohen/DretskeVsLehrer: keine Identifikation einer Wschk von 1 mit einer Grenze von 1. BrendelVsDretske/Brendel: der Begriff der Wschk bzw. Häufigkeit ist nur sinnvoll bei wiederholbaren Fällen, Bei Dretske geht es jedoch meist um einmalige Ereignisse. Lösung/Loewer/Brendel: seinen Informationsbegriff ohne Wschk reformulieren. Lösung/Dretske: nomische Regularität zwischen Ereignistypen, die nomisch das Vorkommen von r ausschließt, wenn s nicht F ist. I 209 BrendelVsDretske: diese Verschiedenheit des fraglichen Vorwissens sichert noch nicht die Rekursivität. Zirkularität muss direkt ausgeschlossen werden: Das tut Dretske jedoch nicht. 2. BrendelVsDretske: was ist „kausale Stützung“: auch sie ist vom Wissen abhängig, Bsp Interpretation eines Klopfens an der Tür. I 212 BrendelVsDretske: er zeigt nicht, die man diese nomologische Verbindung (informationale Relation) erkennen kann. D.h. wir haben gar keine Anwendungsbedingungen. …+… I 217 Wissen/BrendelVsDretske: wenn wir nun zwei Wissensbegriffe nötig hätten, hieße das, dass Dretske Wissen nicht definiert hat. SkeptizismusVsDretske/Brendel: woher sollten wir ein solches grundlegendes Wissen haben? Und wie könnten wir sicher sein, dass wir es besitzen? Woher wissen wir, dass alle Alternativen berücksichtigt wurden? Das beantwortet Dretske nicht. |
Bre I E. Brendel Wahrheit und Wissen Paderborn 1999 |
| Gewinn Spiel | Brendel Vs Dretske, Fred | I 204 Def Information/Dretske/Brendel: kein quantitatives Maß, das die beim Empfänger beseitigte Unbestimmtheit angibt, sondern das Rohmaterial, aus dem Bedeutungen entstehen. I 205 Sie ist eine objektive Ware, deren Schaffung, Übertragung und Rezeption keine Interpretation voraussetzt oder erfordert. Signal/Dretske: Bsp Dinge, Sachverhalte, Ereignisse, Zeichen, Nachrichten usw. sie tragen Informationen. Kognitiv Handelnde können aus ihnen Wissen Gewinnen. Informationsgehalt/Dretske: es geht darum, den IG dieser Signale zu bestimmen. Def Information/Informationsgehalt/Dretske/Brendel: ein Signal r trägt die Information, dass s F ist, = die konditionale Wahrscheinlichkeit (Wschk) von s, F zu sein, gegeben r (und k) ist 1 (aber gegeben k allein, weniger als 1). (Dretske 1981a, 65). k: ist das, was der Empfänger schon weiß. Information/Dretske/Brendel: These: ist vorsprachlich, Bsp ein Verkehrszeichen. Keine Aussage. Problem: das kann so nicht in eine logische Form eingefügt werden. Dretske: Z „Am Anfang war Information. Das Wort kam später“. I 206 Wschk/Dretske/Brendel: soll die subjektive Komponente einführen, dass ein und dasselbe Ding für Subjekte mit verschiedenem Vorwissen verschiedene Informationen übermitteln kann. Wschk/Dretske/Brendel: er kann keine subjektive Wschk meinen, denn dann verliert der Informationsbegriff völlig seinen objektiven Charakter. objektive Wschk/Brendel: ist aber relative Häufigkeit (relH) bzw. deren Grenzwert, der Limes der relH von F in G. Problem: auch das kann von Dretske nicht intendiert sein, weil wenn die Bezugsklasse G unendlich ist, so ist der Grenzwert eine Schätzung, da man nur endlich viele Beobachtungen machen kann. Dann könnte eine Wschk von 1 erhalten werden, ohne dass dies dem tatsächlichen Grenzwert entspricht. Wschk/Dretske: eine solche lehnt er daher explizit ab. I 207 Lösung/Dretske: Wschk als relH zwischen Bedingungstypen. 1. es muss kein endliches BeiSpiel sein, dass die aktuale Wschk reflektiert. 2. die Relation, von der die Kommunikation von Inhalten abhängt, ist die gesetzmäßige Abhängigkeit einer Bedingung von einer anderen. DretskeVsCohen/DretskeVsLehrer: keine Identifikation einer Wschk von 1 mit einer Grenze von 1. BrendelVsDretske/Brendel: der Begriff der Wschk bzw. Häufigkeit ist nur sinnvoll bei wiederholbaren Fällen, Bei Dretske geht es jedoch meist um einmalige Ereignisse. Lösung/Loewer/Brendel: seinen Informationsbegriff ohne Wschk reformulieren. Lösung/Dretske: nomische Regularität zwischen Ereignistypen, die nomisch das Vorkommen von r ausschließt, wenn s nicht F ist. I 209 BrendelVsDretske: diese Verschiedenheit des fraglichen Vorwissens sichert noch nicht die Rekursivität. Zirkularität muss direkt ausgeschlossen werden: Das tut Dretske jedoch nicht. 2. BrendelVsDretske: was ist „kausale Stützung“: auch sie ist vom Wissen abhängig, Bsp Interpretation eines Klopfens an der Tür. I 212 BrendelVsDretske: er zeigt nicht, die man diese nomologische Verbindung (informationale Relation) erkennen kann. D.h. wir haben gar keine Anwendungsbedingungen. …+… I 217 Wissen/BrendelVsDretske: wenn wir nun zwei Wissensbegriffe nötig hätten, hieße das, dass Dretske Wissen nicht definiert hat. SkeptizismusVsDretske/Brendel: woher sollten wir ein solches grundlegendes Wissen haben? Und wie könnten wir sicher sein, dass wir es besitzen? Woher wissen wir, dass alle Alternativen berücksichtigt wurden? Das beantwortet Dretske nicht. |
Bre I E. Brendel Wahrheit und Wissen Paderborn 1999 |
| Gewinn Spiel | Tugendhat Vs Dummett, Michael | I 253 Bedeutung/Behauptung/Dummett/Tugendhat: Bsp Spiel: Behauptungshandlung, Behauptung und Gegenbehauptung, "ja"/"nein" entspricht "wahr"/"falsch" einer gewinnt, einer verliert. Dieses Schema soll jeder Äußerungen jedes assertorischen Satzes zugrunde liegen! I 254 Der Sprecher übernimmt eine Garantie, die vom Hörer in Zweifel gezogen wird. (Searle so ähnlich, s. o.). I 255 Neu: es wird umgekehrt gesagt: wenn der Ausdruck verwendet wird, welches dann die Bedingungen sind, unter denen er richtig ist. Das setzt voraus: 1. dass die Bedingungen, in denen der Ausdruck verwendet wird für die Richtigkeit der Verwendung gleichgültig sind. 2. dass die Bedingungen von denen die Richtigkeit abhängt, solche sind, deren Erfülltsein von der Verwendung des Ausdrucks selbst garantiert wird. Was der Ausdruck garantiert, ist, dass die Bedingungen seiner Richtigkeit (Wahrheit) erfüllt sind! Die Äquivalenz "p ⇔ dass p ist wahr" gründet darin, dass derjenige, der etwas behauptet, immer schon die Richtigkeit mitbehauptet. I 256 Sprecher: Bedingungen und Vorhandensein zusammen garantiert. Hörer: trennt beides und stellt es getrennt in Frage. (Asymmetrie). I 256/257 TugendhatVsDummett/TugendhatVsSearle: unbefriedigend: 1. Es ist noch nichts darüber gesagt worden, welches die Wahrheitsbedingungen einer Behauptung bzw. eines Satzes sind. Eine Möglichkeit wäre zu sagen, dass die Wahrheitsbedingungen eines Satzes ihrerseits durch einen Satz angegeben werden. Das setzt natürlich voraus, dass für die Erklärung eines Satzes immer schon ein anderer Satz zur Verfügung steht. Metasprache. (TugendhatVs). Die Erklärung muss in einer Verwendungsregel liegen. Es genügt nicht, zu zeigen, dass der erste Satz wie der zweite verwendet wird, es muss gezeigt werden, unter welchen Bedingungen der eine Satz gebraucht wird. 2. Jedes Übernehmen einer Garantie setzt seinerseits die Verwendung eines assertorischen Satzes voraus, das ist also eine Pseudoerklärung. II 231 TugendhatVsDummett: "Bedeutung" bei Frege sollte man nicht mit "Referenz" übersetzen! II 232 Gerechtfertigt nur dort, wo Frege Sätze als Eigennamen auffasst! II 247 Referenz/Tugendhat: durch meine Kritik an der Übersetzung Bedeutung = Referenz habe ich nicht den Primat der Wahrheit vor den Gegenständen in Frage gestellt. DummettVsTugendhat: es genügt nicht, die Bedeutung von Namen lediglich als Wahrheitswertpotential zu erklären: 1.die Bedeutung könnte dann als bloße Äquivalenzklasse von Ausdrücken aufgefasst werden. TugendhatVsDummett: richtig bei Sätzen und Prädikaten, bei Namen muss man sich nicht damit begnügen. DummettVsTugendhat: 2. Dass zwei Namen "a" und "b" dieselbe Bedeutung haben, wenn sie dasselbe Wahrheitswertpotential haben, gilt nur bei extensionalen Prädikaten. Aber mit welchem Kriterium kann man extensionale von intensionalen Prädikaten unterscheiden? Es setzte voraus, dass wir ein Kriterium für die Bedeutungsgleichheit von Namen hätten, das nicht erst durch das Leibnizsche Gesetz festgelegt wird. II 248 Leibnizsches Gesetz/Dummett: kann nicht als Definition von "=" aufgefasst werden, sondern gründet darin, dass, wenn wir etwas von einem Gegenstand prädizieren, der Wahrheitswert der Behauptung unabhängig sein muss von der Gegebenheitsweise!. TugendhatVsDummett: nicht so bei Frege: Dummett weist selbst darauf hin, dass er das Leibnizsche Gesetz als Definition von "=" aufgefasst hat. Tugendhat: wir können, was wir mit Identität meinen, nicht mit dem Gesetz erklären. Tugendhat pro Dummett. TugendhatVsDummett: mit Sätzen als Äquivalenzklassen hat man nicht den Bezug zur Welt verloren: es geht nur um ganz bestimmte Äquivalenzklassen, die natürlich durch die Beschaffenheit der Welt bestimmt sind. Dummett: Sätze nicht gleich Namen! (VsFrege). II 249 Referenz/Dummett: > II 250 Referenz/Frege: er hat nie von Referenz gesprochen Prädikate/Frege: er hat nie davon gesprochen, dass die Bedeutungen von Prädikaten als "Quasi-Gegenstände" verstanden werden müssten. Dummett/Tugendhat: der berechtigte Kern an Dummetts Kritik: aus dem Wahrheitswertpotential folgt noch nicht, dass die Bedeutung eines Namens ein Gegenstand sei. |
Tu I E. Tugendhat Vorlesungen zur Einführung in die Sprachanalytische Philosophie Frankfurt 1976 Tu II E. Tugendhat Philosophische Aufsätze Frankfurt 1992 |
| Gewinn Spiel | Peacocke Vs Dummett, Michael | II 165 Behauptung/Dummett: im strikten Sinn kann dann charakterisiert werden als eine Quasi Behauptung, deren Rechtfertigungskriterium mit den Wahrheitsbedingungen für den entsprechenden Gedanken zusammenfällt. PeacockeVsDummett: damit ist er im Zirkel! Wir müssen uns daran erinnern, daß es eine Adäquatheitsbedingung ist, daß jeder Zugang die Verbindung zwischen Wahrheit und Behauptung (besser Sagen) liefert: eine Aussage ist war, wenn die Dinge so sind, wie er es in der Äußerung sagt. Wie soll man also vorgehen? Parallele zum Spiel: Def Gewinn/Peacocke: wenn man die Ziele erfüllt, die man qua Spieler hat. Wir müssen also zeigen, daß in der Sprache die eine Gemeinschaft hat ein Spiel geSpielt wird anstelle von einem anderen. Und bei der Analyse dürfen wir keine solchen Begriffe wie "Gewinnen" oder "Ziele qua Spieler" gebrauchen. |
Peacocke I Chr. R. Peacocke Sense and Content Oxford 1983 Peacocke II Christopher Peacocke "Truth Definitions and Actual Languges" In Truth and Meaning, G. Evans/J. McDowell Oxford 1976 |
| Gewinn Spiel | Leeds Vs Field, H. | Field II 304 Unbestimmtheit /Mengenlehre/ML/Leeds/Field: Bsp jemand hält den Begriff "Menge" für unbestimmt, dann kann er statt dessen sagen: die Extension des Begriffs sei "so groß wie möglich". (Leeds 1997,24) (s) "alles, was unter den Begriff fällt"). Dann kann der Begriff enger und weiter gefaßt werden. Mächtigkeit des Kontinuums/Unbestimmtheit/Field: diese Unbestimmtheit müßte aber mindestens ebenso sehr den Begriff der Elementbeziehung umfassen. LeedsVsField: es ist inkohärent, Mengenlehre zu akzeptieren und gleichzeitig ihre Begriffe als unbestimmt zu bezeichnen. Insbesondere, dann auch noch die klassische Logik darauf anzuwenden. Field: das kann auch so aussehen, besonders, daß man die philosophischen Kommentare von der Mathematik trennen soll. Aber wir müssen die Trennung von der Praxis gar nicht vornehmen: Bsp wenn der Glaube in Unbestimmtheit sich darin äußert, ob der Glaubensgrad des Mathematikers in die Kontinuumshypothese und sein "Zweifelsgrad" in dieselbe sich zu 1 summieren. ((s) Daß es keinen Raum für eine dritte Möglichkeit gibt.) Problem: ein Mathematiker, für den sie sich zu 1 summieren kann sich fragen, "Ist die Kontinuumshypothese korrekt?" und dafür mathematische Beweise suchen. Aber ein andere Mathematiker, für den die Glaubensgrade zu 0 summieren ((s) weil er weder an die Kontinuumshypothese noch an die Negation glaubt) wird die Suche nach einem Beweis für irregeleitet halten. Jede Möglichkeit sei es wert, verfolgt zu werden. Die Idee hinter der Unbestimmtheit ist aber, daß es wenig zu bestimmen gibt jenseits der akzeptierten Axiome. ((s) Keine Tatsache). Kontinuumshypothese/Field: praktische Erwägungen mögen einer Auffassung in einem bestimmten Kontext den Vorzug geben, einer anderen in einem anderen Kontext. Lösung/Field: das ist kein Problem, so lange diese Kontexte getrennt gehalten werden. Es zeigt aber, daß die Nützlichkeit für den Mathematiker unabhängig von der Wahrheit ist. II 305 Williamsons/Rätsel/Unbestimmtheit/Leeds/Field: (LeedsVsField): (Bsp es muß bestimmt sein, ob Joe reich ist oder nicht): Lösung/Leeds: i) wir schließen die fraglichen Begriffe, hier z.B. "reich" aus der Teilsprache aus, die wir als "erster Klasse" annehmen und ii) beschränken den primären (disquotationalen) Gebrauch von "referiert" bzw. "ist wahr von" auf diese Teilsprache. Unbestimmtheit/Leeds: liegt dann einfach darin, daß es keine einheitlich beste Weise der Übersetzung in die Teilsprache gibt, auf die wir das Zitattilgungsschema anwenden. Field: das ist genial: alle Unbestimmtheit auf die Unbestimmtheit der Übersetzung zu reduzieren. FieldVsLeeds: ich bezweifle aber, daß man dem letztlich Sinn abGewinnen kann. Problem: zwischen unbestimmten Termini und solchen Termini zu unterscheiden, die sich bloß in der Extension von denen der Teilsprache "erster Klasse" unterscheiden. Insbesondere, wenn wir mehrere Übersetzungen in unsere Teilsprache haben, die sich untereinander in der Extension unterscheiden. Lösung/Disquotationalism: dieser würde die fremden Terme in der eigenen Sprache integrieren. Dann dürfen wir zitieren. (Quine, 1953 b, 135. s.o. Kap. IV II 129-30). Problem: wenn wir "/" und "" integrieren droht die Lösung die wir oben erhalten hatten, zu verschwinden. FieldVsLeeds: ich fürchte, das letztendliche Ziel wird nicht erreicht: Unbestimmtheit der Ausdrücke in unserer eigenen Sprache auszuschließen. Das scheint sogar für unsere wissenschaftlichen Begriffe unmöglich! Bsp Wurzel –1/√-1/Brandom/Field: hier ist die Unbestimmtheit nicht beseitigt: wir können die Teilsprache "erster Klasse" einfach dazu gebrauchen zu sagen, dass –1 zwei Wurzeln hat, ohne einen Namen wie "i" einzuführen, der "für eine von beiden stehen" soll. FieldVsLeeds: wir können Mengenlehre akzeptieren, ohne ihre Sprache als "erster Klasse" anzunehmen. ((s) Aber die Idee war doch, die mengentheoretischen Begriffe aus der Teilsprache erster Klasse zu eliminieren und "wahr von" und "referiert" auf die Teilsprache zu beschränken). Field: das können wir sogar, wenn wir den Platonismus annehmen (eigentlich FieldVsPlatonismus) : II 306 Bsp wir nehmen eine fundamentale Theorie T die kein mengentheoretisches Vokabular hat, sondern nur sagt, daß es unendlich viele nicht-physikalische ewig existierende Objekte gibt und die die Konsistenz der basalen Mengenlehre postuliert. (Widerspruchsfreiheit ist dann der Grundbegriff, der von seinen eigenen Axiomen geregelt wird und nicht in mengentheoretischen Begriffen erklärt ist. (Field 1991). Dann übersetzen wir die Sprache der Mengenlehre in T indem wir "Menge" als wahr von einigen oder allen der nicht-physikalischen ewig existierenden Objekte annehmen und "Element von" so interpretieren, dass die normalen Axiome wahr bleiben. Dann gibt es mehrere Weisen, das zu tun, und verschiedene machen verschiedene Sätze über die Mächtigkeit des Kontinuums wahr. Dann hat die Kontinuumshypothese keinen bestimmten Wahrheitswert. (Kontinuumshypothese; >ohne Wahrheitswert). Problem: wenn wir mathematische Anwendungen auf nichtmathematische Gebiete ausdehnen, brauchen wir nicht nur mathematische Widerspruchsfreiheit, sondern auch WSF mit diesen anderen Gebieten. Und man müsste auch annehmen, daß die entsprechenden außer-mathematischen Theorien platonistisch reformuliert werden könnte. 1. Das könnte man, indem man sie durch eine nominalistische (!) Theorie ersetzt. 2. man könnte die platonistische Theorie durch die Forderung ersetzen, daß alle nominalistischen Konsequenzen von T-plus-gewählte-Mengelehre wahr sind. FieldVs: letzteres sieht wie ein billiger Trick aus, aber hier muß die gewählte Mengenlehre nicht eine sein, die die Mächtigkeit des Kontinuums entscheidet. Auch muß die gewählte Mengenlehre für eine physikalische oder psychologische Theorie nicht mit der für ein anderes Gebiet kompatibel sein. Das zeigt, daß die Wahrheit der ML nicht in einem übergeordneten Bezugssystem angenommen wird. Es geht nur um instrumentelle Nützlichkeit. FieldVsLeeds: wir können Unbestimmtheit in unserer eigenen Sprache nicht ausschließen, die weit über Vagheit hinausgeht, selbst wenn wir seine Lösung zugestehen. Aber auch das müssen wir nicht: meine Lösung scheint mir attraktiver. I 378 Wahrheit/W-Theorie/W-Begriff/Leeds: wir müssen jetzt unterscheiden zwischen a) Wahrheits-Theorie (T-Theory) ((s) in der Objektsprache) und b) Theorien des Begriffs der Wahrheit ((s) metasprachlich, MS) . Field: (1972): These: wir brauchen eine SI Theorie der Wahrheit und der Referenz (dass eine Standard Interpretation immer verfügbar ist), und diese Theorie ist auch erhältlich. (LeedsVsStandard-Interpretation/VsSI//LeedsVsField). Field/Leeds: sein Argument beruht auf einer Analogie zwischen Wahrheit und (chemischer) Valenz. (..+....). Field: These: wenn es so ausgesehen hätte, dass man sie nicht reduzieren könnte, wäre das ein Grund gewesen, die Theorie der Valenzen aufzugeben. Und zwar trotz der Nützlichkeit der Theorie! Wahrheit/Field: These: (in Analogie zur Valenz): trotz allem was wir über die Extension des Begriffs wissen, auch für ihn gibt es noch die Notwendigkeit einer physikalistisch akzeptablen Reduktion! Leeds: was Field eine physikalistisch akzeptable Reduktion nennen würde, wäre das, was wir die SI Theorie der Wahrheit nennen: dass es immer eine Standard Interpretation für "wahr" für eine Sprache gibt. Field/Leeds: Field suggeriert, dass es möglich ist, so etwas am Ende zu entdecken. LeedsVsField: betrachten wir die Analogie genauer: Frage: wäre eine bloße Liste von Elementen und Zahlen (Statt Valenzen) nicht akzeptabel? I 379 Das wäre keine Reduktion, weil die Chemiker das Gesetz der Valenz formuliert hatten. Physikalismus/Naturgesetz/Leeds: verlangt nicht, dass alle Begriffe in einer einfachen oder natürlichen Weise erklärt werden können, sondern dass fundamentale Gesetze einfach formulierbar sind. Reduktion/Leeds: nur weil das Wort "Valenz" in einem strikten Gesetz vorkommt, sind der Reduktion strenge Beschränkungen auferlegt. Wahrheit/Tarski/LeedsVsTarski: die Tarskischen Definitionen von T und R erzählen uns nicht die ganze Geschichte über Referenz in Englisch und Wahrheit in Englisch. Referenz/Wahrheit/Leeds: diese Relationen haben eine Natürlichkeit und Wichtigkeit, die nicht in einer bloßen Liste erfaßbar sind. Field/Reduktion/Leeds: wenn wir eine Reduktion à la Field wollen, müssen wir eine Analogie zum Gesetz der Valenzen für den Fall der Wahrheit finden. D.h. wir müssen ein Gesetz oder eine Regularität über Wahrheit in Englisch finden. Analogie/Field: (und viele andere) sehen in der Nützlichkeit des Wahrheits-Begriffs die Analogie zum Gesetz. LeedsVsField: die Nützlichkeit kann aber vollständig ohne eine SI Theorie erklärt werden. Es ist einfach nicht überraschend, dass wir Verwendung für ein Prädikat P haben, mit der Eigenschaft, dass "’__’ ist P" und "__" immer austauschbar sind. ((s)>Redundanztheorie). Und zwar weil wir oft in einer Position sind, dass wir jeden Satz in einer gewissen unendlichen Menge z (z.B. wenn alle Elemente die Form gemeinsam haben) behaupten möchten. ((s) "Alle Sätze der Form "a = a" sind wahr"), >Verallgemeinerung. Verallgemeinerung/W-Prädikat/Leeds: logische Form: (x)(x ε z > P(x)). Semantischer Aufstieg/Abstieg/Leeds: dafür ist dann Wahrheit ein bequemer Begriff. Ebenso für unendliche Konjunktion und Disjunktion. I 386 Pointe: dann ist also der Begriff der Wahrheit theoretisch verzichtbar! Es scheint mir nicht ausgeschlossen, dass man eine Sprache mit unendlichen Konjunktionen und Disjunktionen lernen könnte. Und zwar, wenn sie in Inferenzen so behandelt werden. Sie können endlich notiert werden. I 380 Wahrheit/Leeds: dass sie nützlich ist bei dem was Quine "Disquotation" nennt, ist noch keine Theorie der Wahrheit (W-Theorie). Nutzen/Erklärung/W-Theorie/Leeds: um die Nützlichkeit des W-Begriffs zu erklären, brauchen wir nichts über die Relationen zwischen Sprache und Welt zu sagen. Referenz braucht dann keine wichtige Rolle zu Spielen. Lösung/Leeds: wir haben hier keine W-Theorie, sondern eine Theorie des Wahrheitsbegriffs. D.h. eine Theorie darüber, warum der Begriff in jeder Sprache als nützlich angesehen wird. Diese Erklärung scheint allein auf formalen Merkmalen unserer Sprache zu beruhen. Und das ist ganz unabhängig von irgend welchen Relationen der "Abbildung" oder Referenz auf die Welt. Das können wir so überprüfen: Angenommen, wir haben ein großes Fragment unserer Sprache, für das wir den Instrumentalismus annehmen, nämlich, dass einige Wörter nicht referieren. Das gilt für Soziologie, Psychologie, Ethik usw. Dann werden wir semantischen Aufstieg nützlich finden, wenn wir über z.B. Psychologie sprechen. Bsp „Einige von Freuds Thesen sind wahr, andere falsch“ (Statt „Überich“ zu gebrauchen!). Referenz/Wahrheit/Wahrheits-Begriff/Leeds: das zeigt, wie wenig die Nützlichkeit des Wahrheits-Begriffs von einer erfolgreichen Referenz Relation abhängt! . Dass der Wahrheitsbegriff nützlich ist, hängt gar nicht davon ab, ob Englisch "die Welt abbildet". I 381 Standard-Interpretation/Leeds: und das sollte unsern Glauben daran erschüttern, dass T natürlich, oder ein Standard wäre. Tarski/Leeds: das sollte uns wiederum nicht davon abhalten, "T" à la Tarski zu definieren. Und dann ist es vernünftig anzunehmen, dass "x ist wahr in Englisch gdw. T(x)" analytisch ist. LeedsVsSI: dann haben wir zwei Möglichkeiten, ohne SI auszukommen: a) wir können Tatsachen über Wahrheit in Englisch unter Berufung auf die W-Def ausdrücken, (wenn das Wort "wahr" gebraucht wird) oder b) unter Berufung auf die disquotationale Rolle des W-Begriffs. Und zwar, wenn das Explanandum das Wort "wahr" innerhalb von Anführungszeichen enthält (in obliqua, (s) erwähnt). Bekanntschaft/Russell/M. Williams: meinte damit ein direktes mentales Erfassen, keine Kausalrelation! Das ist die ältere Form der Korrespondenztheorie. I 491 Ihm ging es dabei um RussellVsSkeptizismus: um eine Grundlegung für Wissen und Bedeutung. FieldVsRussell/M. WilliamsVsRussell: das ist genau das Antackern des Begriffsschemas von außen an die Welt. Field/M. Williams: sein Projekt ist dagegen mehr metaphysisch als epistemisch. Er will einen umfassenden physikalistischen Überblick. Dazu muss er zeigen, wie semantische Eigenschaften in eine physikalische Welt passen. Wenn Field recht hätte, hätten wir einen Grund, uns auf eine starke Korrespondenztheorie zu verpflichten, aber ohne zweifelhafte epistemische Projekte, die normalerweise damit verknüpft sind. . LeedsVsField/M. Williams: sein Argument ist aber nicht erfolgreich. Er beantwortet die Frage VsDeflationismus nicht. Denn angenommen, die Rede über Wahrheit lässt sich nicht physikalistisch erklären, dann widerspricht das der Forderung, dass es eine eindeutige Kausalordnung gibt. Lösung: Wahrheit darf keine erklärende Rolle spielen (s.o.). Sonst haben wir es wieder mit Epistemologie (Erkenntnistheorie) zu tun. (>Rechtfertigung, Akzeptierbarkeit). |
Leeds I Stephen Leeds "Theories of Reference and Truth", Erkenntnis, 13 (1978) pp. 111-29 In Truth and Meaning, Paul Horwich Aldershot 1994 Field I H. Field Realism, Mathematics and Modality Oxford New York 1989 Field II H. Field Truth and the Absence of Fact Oxford New York 2001 Field III H. Field Science without numbers Princeton New Jersey 1980 Field IV Hartry Field "Realism and Relativism", The Journal of Philosophy, 76 (1982), pp. 553-67 In Theories of Truth, Paul Horwich Aldershot 1994 |
| Gewinn Spiel | Strawson Vs Frege, G. | Searle III 213 Tatsache/Aussage/Strawson: hier gibt es nicht zwei unabhängige Gebilde, Tatsachen sind das, was Aussagen aussagen. Sie sind nicht das, worüber die Aussagen Aussagen sind. Tatsachen: sind nicht sprachunabhängige Dinge in der Welt. Sie enthalten wie "Aussage" und "wahr" selbst einen gewissen Typ von Diskurs in sich. Frege: Tatsachen sind einfach wahre Aussagen.(!) (Strawson und AustinVs). Bsp es gibt auch nicht zwei getrennte Typen von Ereignissen wie Gewinnen und Sieg. Der Sieg besteht eben im Gewinnen. III 214 StrawsonVsFrege: es wäre aber falsch, hier eine genaue Analogie zu ziehen (Allerdings nicht aus Austins Gründen). Tatsache und Aussage sind nicht identisch, weil sie verschiedene Rollen in unserer Sprache spielen! Tatsachen fungieren in einer Weise kausal, wie das wahre Aussagen nicht tun. |
Strawson I Peter F. Strawson Einzelding und logisches Subjekt Stuttgart 1972 Strawson II Peter F. Strawson "Truth", Proceedings of the Aristotelian Society, Suppl. Vol XXIV, 1950 - dt. P. F. Strawson, "Wahrheit", In Wahrheitstheorien, Gunnar Skirbekk Frankfurt/M. 1977 Strawson III Peter F. Strawson "On Understanding the Structure of One’s Language" In Truth and Meaning, G. Evans/J. McDowell Oxford 1976 Strawson IV Peter F. Strawson Analyse und Metaphysik München 1994 Strawson V P.F. Strawson Die Grenzen des Sinns Frankfurt 1981 Strawson VI Peter F Strawson Grammar and Philosophy in: Proceedings of the Aristotelian Society, Vol 70, 1969/70 pp. 1-20 In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Strawson VII Peter F Strawson "On Referring", in: Mind 59 (1950) In Eigennamen, Ursula Wolf Frankfurt/M. 1993 Searle I John R. Searle Die Wiederentdeckung des Geistes Frankfurt 1996 Searle II John R. Searle Intentionalität Frankfurt 1991 Searle III John R. Searle Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit Hamburg 1997 Searle IV John R. Searle Ausdruck und Bedeutung Frankfurt 1982 Searle V John R. Searle Sprechakte Frankfurt 1983 Searle VII John R. Searle Behauptungen und Abweichungen In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Searle VIII John R. Searle Chomskys Revolution in der Linguistik In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Searle IX John R. Searle "Animal Minds", in: Midwest Studies in Philosophy 19 (1994) pp. 206-219 In Der Geist der Tiere, D Perler/M. Wild Frankfurt/M. 2005 |
| Gewinn Spiel | Waismann Vs Frege, G. | Waismann I 77 Frege: Definition der Zahl in zwei Schritten a) wann sind zwei Mengen gleichzahlig. b) Definition des Begriffs der "Anzahl": sie ist gleich, wenn jedem Element der einen ein Element der anderen Menge entspricht. Eineindeutige Relation. Unter Def "Zahl einer Menge"/Frege: versteht er die Menge aller mit ihr gleichzahligen Mengen. Bsp Die Zahl 5 ist die Gesamtheit aller Fünferklassen in der Welt. VsFrege: wie sollen wir feststellen dass zwei Mengen gleichzahlig sind? Offenbar durch Aufweisung einer solchen Relation. Bsp Wenn man dazu etwa Löffel auf Tassen verteilen muss, dann hat die Relation vorher also nicht bestanden. Solange die Löffel nicht auf den Tassen lagen, waren die Mengen nicht gleichzahlig. Das entspricht aber nicht dem Sinn, in dem man das Wort gleichzahlig verwendet. Also geht es darum, ob man die Löffel an die Tassen legen kann. Aber was bedeutet "kann"? I 78 Dass gleich viele Exemplare vorhanden sind. Nicht die Zuordnung bestimmt die Gleichzahligkeit, sondern umgekehrt. Die vorgeschlagene Definition gibt zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Gleichzahligkeit und fasst den Ausdruck "gleichzahlig" zu eng. Klasse: Liste ("Schulklasse") logisch oder Begriff (Säugetiere) empirisch. Bei zwei Listen ist es weder emopirisch noch logisch zu sagen, sie lassen sich einander zuordnen. Bsp 1.Sind in diesem Zimmer ebenso viele Personen wie im Nebenzimmer? Ein Experiment liefert die Antwort. 2. Sind 3x4 Tassen gleichzahlig mit 12 Löffeln? Man kann das durch Ziehen von Linien beantworten, was kein Experiment ist, sondern ein Vorgang in einem Kalkül. Nach Frege sind zwei Mengen nicht gleichzahlig, wenn man die Relation nicht herstellt. Man hat zwar etwas definiert, aber nicht den Begriff "gleichzahlig". Man kann die Definition erweitern, indem man davon spricht, dass sie zugeordnet werden können. Aber das ist wieder nicht richtig. Denn sind die beiden Mengen durch ihre Eigenschaften gegeben, so ist es immer sinnvoll, ihr Zugeordnetsein zu behaupten, (das hat aber einen verschiedenen Sinn, je nach dem Kriterium, an dem man die Möglichkeit der Zuordnung erkennt: dass die beiden gleichzahlig sind, oder dass es Sinn haben soll, von einer Zuordnung zu sprechen! Tatsächlich gebrauchen wir das Wort "gleichzahlig" nach verschiedenen Kriterien: von welchen Frege nur ein einziges hervorhebt und zum Paradigma macht. Bsp 1. Liegen auf dem Tisch 3 Tassen und 3 Löffel, so sieht man auf einen Blick die Zuordenbarkeit. II 79 2. Ist die Anzahl nicht übersehbar, sie aber in eine übersichtliche Form geordnet, z.B. Quadrat oder Raute, springt wieder die Gleichzahligkeit ins Auge. 3.Anders ist der Fall, wenn wir etwas von zwei Fünfecken feststellen, dass sie dieselbe Anzahl von Diagonalen haben. Hier fassen wir die Gruppierung nicht mehr unmittelbar auf, es ist vielmehr ein Satz der Geometrie. 4. Gleichzahlig bei eineindeutiger Zuordenbarkeit 5.Das normalen Kriterium der Zahlengleichheit ist aber das Zählen, (das nicht als Abbildung zweier Mengen durch eine Beziehung aufgefasst werden darf.) WaismannVsFrege: Diesen verschiedenen und biegsamen Gebrauch gibt Freges Definition nicht wieder. I 80 Das führt zu seltsamen Konsequenzen: Nach Frege müssen zwei Mengen notwendig gleichzahlig sein oder nicht und zwar aus logischen Gründen. Bsp Angenommen, der Sternenhimmel: Jemand sagt: "ich weiß zwar nicht wie viele ich gesehen habe, aber eine bestimmte Anzahl müssen es gewesen sein." Wie unterscheide ich diese Aussage von "Ich habe viele Sterne gesehen". ((Es geht um die Zahl der gesehenen, nicht der vorhandenen Sterne). Wenn ich noch einmal zurück könnte zu der Situation, könnte ich sie nachzählen. Aber das geht nicht. Es gibt keine Methode, die Anzahl festzustellen, und damit verliert die Zahlangabe ihren Sinn. Bsp’ Man könnte die Sache aber auch anders sehen: eine kleine Anzahl von Sternen kann man noch zählen, etwa 5. Hier haben wir eine neue Zahlenreihe: 1,2,3,4,5, viele. Das ist eine Reihe, die manche primitive Völker wirklich gebrauchen. Sie ist durchaus nicht unkomplett. und wir sind nicht im Besitz einer kompletteren, sondern nur eine komplizierteren, neben der die primitive zu recht besteht. Man kann auch in dieser Reihe addieren und multiplizieren und das in voller Strenge. Angenommen, die Dinge der Welt würden wie Tropfen an uns verbeischweben, dann wäre diese Zahlenreihe durchaus angemessen. Bsp Angenommen, wir sollten Dinge zählen, die während des Zählens wieder verschwinden oder andere entstehen. Solche Erfahrungen würde unsere Begriffsbildung in ganz andere Bahnen lenken. Vielleicht würden Worte wie "Viel", "wenig" evtl. verfeinert, an die Stelle unserer Zahlworte treten. I 80/81 VsFrege: seine Definition geht an alldem vorbei. Nach ihr sind zwei Mengen logisch notwendig gleichzahlig, ohne Wissen, oder sie sind es nicht. Genauso hatte man vor Einstein argumentiert, zwei Ereignisse seine gleichzeitig, unabhängig von Beobachtung. Aber so ist es nicht, sondern der Sinn einer Aussage erschöpft sich in der Art ihrer Verifikation (auch Dummett) Waismann: man muss also auf das Verfahren zur Feststellung der Gleichzahligkeit achten, und das ist viel komplizierter als Frege meinte. Frege: zweiter Teil der Zahldefinition: Def Zahl/Frege: ist eine Klasse von Klassen. ((s) Anderswo: so nicht von Frege! FregeVs!). Bsp Dem Begriff "Apfel, der auf dem Tisch liegt, kommt die Zahl 3 zu". Oder: die Klasse der auf dem Tisch liegenden Äpfel ist ein Element der Klasse 3. Das hat den großen Vorzug der Evidenz: dass nämlich die Zahl nicht von den Dingen, sondern von dem Begriff ausgesagt wird. WaismannVsFrege: Aber wird das dem tatsächlichen Gebrauch der Zahlworte gerecht? Bsp Im Befehl "3 Äpfel!" hat das Zahlwort gewiss keine andere Bedeutung, aber nach Frege kann dieser Befehl nicht mehr anch dem gleichen Schema gedeutet werden. Es besagt nicht: die Klasse der Äpfel, die zu holen ist, ist Element der Klasse 3. Denn dies ist eine Aussage, und die kennt unsere Sprache nicht. WaismannVsFrege: seine Definition knüpft den Zahlbegriff in unnötiger Weise an die Subjekt Prädikat Form unserer Sätze. Tatsächlich ergibt sie die Bedeutung des Wortes "3" aus der Art seiner Verwendung (Wittgenstein). RussellVsFrege Bsp Angenommen, es gäbe genau 9 Individuen auf der Welt. Dann könnten wir die Kardinalzahlen von 0 bis 9 definieren, aber die 10, als 9+1 definiert, wäre die Nullklasse. Folglich werden die 10 und alle folgenden natürlichen Zahlen miteinander identisch sein, sämtlich = 0. Um das zu vermeiden müsste ein zusätzliches Axiom eingeführt werden, das Def "Unendlichkeitsaxiom"/Russell: besagt, dass es einen Typus gibt, dem unendlich viele Individuen angehören. Das stellt eine Aussage über die Welt dar, und von der Wahrheit dieses Axioms hängt nun wesentlich der Aufbau der ganzen Arithmetik ab. Jedermann wird nun begierig sein zu wissen, ob das Unendlichkeitsaxiom wahr ist. Wir müssen erwidern: wir wissen es nicht. Es ist so beschaffen, dass es sich jeder Prüfung entzieht. Dann müssen wir aber zugestehen, dass seine Annahme keinen Sinn hat. I 82 Es hilft auch nichts, dass man das "Unendlichkeitsaxiom" als Bedingung der Mathematik mitführt, denn so gewinnt man nicht die Mathematik, wie sie tatsächlich vorliegt: die Menge der Brüche ist überall dicht, aber nicht: die Menge der Brüche ist überall dicht, wenn das Unendlichkeitsaxiom zutrifft. Das wäre eine künstliche Umdeutung, nur dazu ersonnen, die Lehre aufrechtzuerhalten, dass die Zahlen aus wirklichen Klassen in der Welt aufgebaut sind (VsFrege: aber nur bedingt, denn Frege spricht nicht von Klassen in der Welt). Waismann I 85 Der Irrtum der Logik war, dass sie glaubte, die Arithmetik fest untermauert zu haben. Frege: "Die Grundsteine, in einem ewigen Grund befestigt, sind von unserem Denken zwar überflutbar, aber nicht verrückbar." WaismannVsFrege: allein der Ausdruck die Arithmetik "begründen" gibt uns ein falsches Bild, I 86 als ob ihr Gebäude auf Grundwahrheiten errichtet sei, während sie ein Kalkül ist, der nur von gewissen Festsetzungen ausgeht, frei schwebend, wie das Sonnensystem, das auf nichts ruht. Wir können die Arithmetik nur beschreiben, d.h. ihre Regeln angeben, nicht begründen. Waismann I 163 Die einzelnen Zahlbegriffe bilden eine Familie. Es gibt Familienähnlichkeiten. Frage: werden sie erfunden oder entdeckt? Wir lehnen die Auffassung ab, dass die Regeln aus der Bedeutung der Zeichen folgen. Betrachten wir Freges Argumente. (WaismannVsFrege) II 164 1.Man kann Arithmetik als ein Spiel mit Zeichen ansehen, aber dann geht der eigentliche Sinn des ganzen verloren. Wenn ich Rechenregeln aufstelle, habe ich dann den "Sinn" des "=" mitgeteilt? Oder nur eine mechanische Anweisung zum Gebrauch des Zeichens gegeben? Doch wohl das letztere. Dann geht aber das Wichtigste der Arithmetik verloren, der Sinn, der sich in den Zeichen ausspricht. (VsHilbert) Waismann: Gesetzt, es sei so, warum beschreiben wir dann nicht lieber gleich den geistigen Vorgang? Ich werde aber mit einer Zeichenerklärung antworten und nicht mit einer Schilderung meines geistigen Zustands, wenn man mich fragt, was 1+ 1 = 2 bedeutet. Wenn man sagt, ich weiß doch, was das Gleichheitszeichen bedeutet, z.B. in Addition, Quadratischen Gleichungen, usw. dann hat man mehrere Antworten gegeben. Der berechtigte Kern von Freges Kritik: wenn man nur die formelhafte Seite der Arithmetik betrachtet und die Anwendung außer acht lässt, erhält man ein bloßes Spiel. Aber was hier fehlt, ist nicht der Vorgang des Verstehens, sondern die Deutung! I 165 Bsp Wenn ich ein Kind außer den Formeln auch noch die Übersetzungen in die Wortsprache lehre, macht es dann bloß mechanischen Gebrauch? Sicher nicht. 2. Argument: Es ist also die Anwendung, die die Arithmetik von einem bloßen Spiel unterscheidet. Frege: "Ohne einen Gedankeninhalt wird auch eine Anwendung nicht möglich sein. WaismannVsFrege: Angenommen, man erfände ein Spiel, das genauso aussieht wie die Arithmetik, aber nur zum Vergnügen dient. Würde es keinen Gedanken mehr ausdrücken? Warum kann man von einer Schachstellung keine Anwendung machen? Weil sie keine Gedanken ausdrückt." WaismannVsFrege: Angenommen, man erfände ein Spiel, das genauso aussieht wie die Arithmetik, aber nur zum Vergnügen dient. Würde es keinen Gedanken mehr ausdrücken? Schach: es ist voreilig zu sagen, dass eine Schachstellung keine Gedanken ausdrückt. Waismann bringt. Bsp Figuren stehen für Truppen. Das könnte aber gerade bedeuten, Die Figuren müssten erst zu Zeichen von etwas gemacht werden. I 166 Erst wenn man bewiesen hat, dass es einen und nur einen Gegenstand von der Eigenschaft gibt, ist man berechtigt, ihn mit dem Eigennamen "Null" zu belegen. Die Null zu schaffen, ist unmöglich. Ein >Zeichen muss etwas bezeichnen, sonst ist es nur Druckerschwärze. WaismannVsFrege: wir wollen das letztere weder bestreiten noch zugeben. Bloß welcher Sinn kommt dieser Behauptung zu? Dass Zahlen nicht dasselbe wie Zeichen sind die wir aufs Papier schreiben, ist klar. Sie werden erst durch den Gebrauch zu dem, was sie sind. Frege meint aber vielmehr: dass die Zahlen vorher schon irgendwie da sind, dass die Entdeckung der imaginären Zahlen ähnlich wie die eines fernen Erdteiles ist. I 167 Bedeutung/Frege: um nicht Tintenkleckse zu sein, müssen die Zeichen eine Bedeutung haben. Und die existiert dann unabhängig von den Zeichen. WaismannVsFrege: die Bedeutung ist der Gebrauch, und über den gebieten wir. |
Waismann I F. Waismann Einführung in das mathematische Denken Darmstadt 1996 Waismann II F. Waismann Logik, Sprache, Philosophie Stuttgart 1976 |
| Gewinn Spiel | Plantinga Vs Gegenstücktheorie | Schwarz I 57 Gegenstück/GT/PlantingaVsLewis/PlantingaVsGegenstück-Theorie: (1974(1),115f,1987(2),209): Lewis zufolge hätten dann alle Dinge streng genommen all ihre Eigenschaften essentiell, da es keine mögliche Welten (MöWe) gibt, in der sie selbst, (nicht nur irgendwelche Stellvertreter) andere Eigenschaften haben. Bsp wäre es heute ein Grad kälter, würden wir alle nicht existieren, weil dann eine andere MöWe wirklich wäre, und keiner von uns wäre dort. Ähnlich Kripke: KripkeVsGegenstück-Theorie/KripkeVsLewis: Bsp wenn wir sagen "Humphrey hätte die Wahl Gewinnen können" reden wir nach Lewis eben nicht von Humphrey, sondern von jemand anderem. Und nichts könnte ihm gleichgültiger sein ("He couldn’t care less"). (Kripke 1980(3),44f). 1. Alvin Plantinga [1974]: The Nature of Necessity. Oxford: Oxford University Press 2. Alvin Plantinga [1987]: “Two Concepts of Modality: Modal Realism and Modal Reductionism”. Philosophical Perspectives, 1: 189–231 3. Saul A. Kripke [1980]: Naming and Necessity. Oxford: Blackwell Schwarz I 100 Eigenschaften/VsGegenstück-Theorie/GT/Schwarz: wenn man Gegenstücke und zeitliche Teile ablehnt, muss man alle Eigenschaften als verkappte Relationen zu Zeiten und MöWe auffassen. Dann gibt es natürlich sehr viel mehr fundamentale Relationen. Stalnaker I 117 Identität/Stalnaker: …diese Beispiele erinnern uns daran, was für eine unflexible Relation Identität ist. Unsere Intuitionen über die Flexibilität von Möglichkeiten widersprechen dieser starren Verfassung der Identität. Gegenstück-Theorie/GT/Stalnaker: sagt uns "Entspann Dich!". Wir sollten für die Querwelteinidentität eine flexiblere Relation einführen, die Intransitivität und Asymmetrie ermöglicht. Gegenstück-Theorie/GT/Stalnaker: die 3. Motivation für sie ist die, die den Phänomenen am nächsten ist und am wenigsten metaphysische Voraussetzungen macht. Vs: der Aktualismus und der Vertreter einer primitiven Diesheit mögen Schwierigkeiten damit haben. I 118 PlantingaVsGegenstücktheorie/Nathan SalmonVsGT/Stalnaker: GT/Plantinga/Salmon: kann man in zwei Doktrinen aufteilen: 1. Metaphysische These: dass die Bereiche verschiedener möglicher Welten (MöWe) sich nicht überlappen ((s) >Lewis: "Nichts ist in zwei Welten"). 2. Semantische These: dass modale Prädikate in Begriffen von Gegenstücken interpretiert werden sollten statt in Begriffen der Individuen selbst. Ad 1.: scheint einen extremen Essentialismus zu suggerieren, nach dem nichts anders hätte gewesen sein können als es aktual ist. Extremer Essentialismus/Plantinga: wäre die These, dass "~wenn ein Blatt im Oktober 1876 in den Bergen der Nördlichen Cascaden einen Tag früher gefallen wäre, als es tatsächlich fiel, ich entweder nichtexistent wäre, oder eine Person, die sich von mir unterscheidet. Und das ist sicher falsch". (Plantinga 1974(4)). ad 2.: kann der semantische Teil der Doktrin das lösen? Plantinga/Salmon: das kann er nicht. Er kann nur die metaphysischen Konsequenzen verschleiern. 4. Alvin Plantinga [1974]: The Nature of Necessity. Oxford: Oxford University Press |
Plant I A. Plantinga The Nature of Necessity (Clarendon Library of Logic and Philosophy) Revised ed. Edition 1979 Schw I W. Schwarz David Lewis Bielefeld 2005 Stalnaker I R. Stalnaker Ways a World may be Oxford New York 2003 |
| Gewinn Spiel | Strawson Vs Grice, P.H. | I 24 StrawsonVsGrice: Bsp Ein Angestellter spielt mit seinem Chef Bridge. Er ist ihm überlegen aber läßt ihn gewinnen. Dabei lächelt er so, daß der Chef merkt, daß er ihn gewinnen läßt, aber nicht so penetrant, daß er ihn für unverschämt hält.Das Lächeln sieht einem spontanen Lächeln sehr ähnlich, aber absichtlich nicht vollkommen ähnlich. Man wird hier nicht sagen wollen, daß er mit dem Lächeln gemeint hat, daß er gute Karten gehabt hat.er beabsichtigt, daß der Chef denkt, er habe gute Karten, aber nicht, daß der beabsichtigt, daß der Chef das denkt! - Zusätzliche Bedingung: H soll denken, daß S eine bestimmte Absicht hat. |
Strawson I Peter F. Strawson Einzelding und logisches Subjekt Stuttgart 1972 Strawson II Peter F. Strawson "Truth", Proceedings of the Aristotelian Society, Suppl. Vol XXIV, 1950 - dt. P. F. Strawson, "Wahrheit", In Wahrheitstheorien, Gunnar Skirbekk Frankfurt/M. 1977 Strawson III Peter F. Strawson "On Understanding the Structure of One’s Language" In Truth and Meaning, G. Evans/J. McDowell Oxford 1976 Strawson IV Peter F. Strawson Analyse und Metaphysik München 1994 Strawson V P.F. Strawson Die Grenzen des Sinns Frankfurt 1981 Strawson VI Peter F Strawson Grammar and Philosophy in: Proceedings of the Aristotelian Society, Vol 70, 1969/70 pp. 1-20 In Linguistik und Philosophie, G. Grewendorf/G. Meggle Frankfurt/M. 1974/1995 Strawson VII Peter F Strawson "On Referring", in: Mind 59 (1950) In Eigennamen, Ursula Wolf Frankfurt/M. 1993 |
| Gewinn Spiel | Davidson Vs Idealismus | Horwich I 449 Davidson/Rorty: kann man ihm (1) – (4) zuschreiben? Er hat (3) oft behauptet, aber (4) scheint nicht zu ihm zu passen, weil er ein „Realist“ ist. (2) klingt auch fremd für ihn. (s.o.): Thesen des Pragmatismus/Rorty: 1. „Wahrheit“ hat keinen erklärenden Gebrauch 2. Wir verstehen alles über die Relation Überzeugung Welt wenn wir die Kausalrelation mit der Welt verstehen. Unser Wissen über den Gebrauch von „über“ und „wahr von“ ist ein Abfallprodukt eines naturalistischen Zugangs zum Sprachverhalten. . 3. Es gibt keine Relation des „Wahrmachens“ oder „Wahrmacher“. 4. Es gibt gar keinen Streit zwischen Realismus und Anti Realismus, weil dieser auf der leeren und irreführenden Annahmen beruht, dass Überzeugungen „wahr gemacht“ werden. Rorty: obwohl Davidson wegen seiner Nähe zu Tarski kein Pragmatist zu sein scheint, denke ich, dass man ihm alle vier pragmatistischen Thesen zuschreiben kann. Korrespondenz/Davidson/Rorty: These der Ansatz über den Feld Linguisten (RI) ist alles, was Davidson denkt, dass man braucht, um Korrespondenz zu verstehen. SprachSpiel/außen/RI/Davidson: der Standpunkt des Feld Linguisten ist der einzig mögliche, sich außerhalb des SprachSpiels aufzustellen. Er versucht, unserem Sprachverhalten einen Sinn abzuGewinnen. Dabei wird gefragt, wie der äußere Beobachter das Wort „wahr“ gebraucht. ((s) Dann müsste man fragen, ob das äußere SprachSpiel die Situation wirklich als inneres SprachSpiel enthält.) DavidsonVsIdealismus: ist metaphysisch, und sucht ontologische Homogenität, hoffnungslos DavidsonVsPhysikalismus: hofft, in Zukunft eine solche Homogenität zu entdecken).(1) 1. Richard Rorty (1986), "Pragmatism, Davidson and Truth" in E. Lepore (Ed.) Truth and Interpretation. Perspectives on the philosophy of Donald Davidson, Oxford, pp. 333-55. Reprinted in: Paul Horwich (Ed.) Theories of truth, Dartmouth, England USA 1994 |
Davidson I D. Davidson Der Mythos des Subjektiven Stuttgart 1993 Davidson I (a) Donald Davidson "Tho Conditions of Thoughts", in: Le Cahier du Collège de Philosophie, Paris 1989, pp. 163-171 In Der Mythos des Subjektiven, Stuttgart 1993 Davidson I (b) Donald Davidson "What is Present to the Mind?" in: J. Brandl/W. Gombocz (eds) The MInd of Donald Davidson, Amsterdam 1989, pp. 3-18 In Der Mythos des Subjektiven, Stuttgart 1993 Davidson I (c) Donald Davidson "Meaning, Truth and Evidence", in: R. Barrett/R. Gibson (eds.) Perspectives on Quine, Cambridge/MA 1990, pp. 68-79 In Der Mythos des Subjektiven, Stuttgart 1993 Davidson I (d) Donald Davidson "Epistemology Externalized", Ms 1989 In Der Mythos des Subjektiven, Stuttgart 1993 Davidson I (e) Donald Davidson "The Myth of the Subjective", in: M. Benedikt/R. Burger (eds.) Bewußtsein, Sprache und die Kunst, Wien 1988, pp. 45-54 In Der Mythos des Subjektiven, Stuttgart 1993 Davidson II Donald Davidson "Reply to Foster" In Truth and Meaning, G. Evans/J. McDowell Oxford 1976 Davidson III D. Davidson Handlung und Ereignis Frankfurt 1990 Davidson IV D. Davidson Wahrheit und Interpretation Frankfurt 1990 Davidson V Donald Davidson "Rational Animals", in: D. Davidson, Subjective, Intersubjective, Objective, Oxford 2001, pp. 95-105 In Der Geist der Tiere, D Perler/M. Wild Frankfurt/M. 2005 Horwich I P. Horwich (Ed.) Theories of Truth Aldershot 1994 |
| Gewinn Spiel | Lewis Vs Kripke, Saul A. | V 251/252 Ereignis/Kennzeichnung/Beschreiben/Benennen/Lewis: Ein Ereignis wird meist durch akzidentelle Eigenschaften spezifiziert. Auch wenn es sogar klar ist, was es bedeutete, es durch sein Wesen zu spezifizieren. Ein Ereignis trifft z.B. auf eine Kennzeichnung zu, hätte sich aber auch ereignen können, ohne auf die Beschreibung zuzutreffen. Def Ereignis/Lewis: Ein Ereignis ist eine Klasse, die aus einer Region dieser Welt zusammen mit verschiedenen Regionen von anderen möglichen Welten (MöWe) besteht, in denen sich das Ereignis hätte ereignen können (weil Ereignisse immer kontingent sind). Was der Beschreibung in einer Region entspricht, entspricht ihr nicht in einer anderen Region (einer anderen Welt). Man kann nie ein vollständiges Inventar der möglichen Beschreibungen (Kennzeichnungen) eines Ereignisses erreichen. 1. Künstliche Beschreibung: Bsp "das Ereignis, das im Urknall besteht wenn Essendon das EndSpiel Gewinnt, aber die Geburt von Calvin Coolidge, wenn nicht", "p > q, sonst r". 2. Teils durch Ursache oder Wirkungen. 3. Durch Referenz auf den Ort in einem System von Konventionen Bsp Unterschreiben des Schecks. 4. Vermischung von wesentlichen und akzidentellen Elementen: Singen, während Rom brennt. Bsp Tripel Eigenschaft, Zeit, Individuum, (s.o.). 5. Spezifikation durch einen Zeitpunkt, obwohl das Ereignis auch früher oder später hätte vorkommen können. 6. Obwohl Individuen wesentlich involviert sein können, können akzidentell zugehörige Individuen herausgehoben werden. 7. Es kann sein, dass ein reiches Wesen eines Ereignisses darin besteht, zu schlendern, aber ein weniger fragiles (beschreibungsabhängiges) Ereignis könnte lediglich akzidentell ein Schlendern sein. ((s) Und es kann unklar bleiben, ob das Ereignis nun wesentlich durch Schlendern charakterisiert ist.) 8. Ein Ereignis, das ein Individuum wesentlich involviert, mag gleichzeitig akzidentell ein anderes Involvieren: Bsp ein bestimmter Soldat, der zufällig zu einer bestimmten Armee gehört. Das entsprechende Ereignis kann nicht in Regionen vorkommen, wo es kein Gegenstück zu diesem Soldat gibt, wohl aber, wenn es ein Gegenstück von dem Soldaten gibt, dieses aber zu einer anderen Armee gehört. V 253 Dann wird die Armee akzidentell involviert, über die Weise ihres Soldaten. 9. Wärme: nicht-starrer Designator (nonrigid): (LewisVsKripke): Nicht starr: Was immer diese Rolle hat oder was immer die und die Manifestation hervorbringt ist nicht starr. Bsp Wärme hätte auch etwas anderes als Molekülbewegung sein können. Lewis: In einer Welt, wo Wärmefluss die entsprechenden Manifestationen hervorbringt, sind heiße Dinge solche, die eine Menge Wärmefluss haben. --- Schwarz I 55 Wesen/Kontextabhängigkeit/LewisVsKripke/SchwarzVsKripke: In bestimmen Kontexten können wir durchaus fragen, Bsp wie es wäre, wenn wir andere Eltern gehabt hätten oder einer anderen Art angehörten. Bsp Statue/Ton: Angenommen, Statue und Ton existieren beide genau gleich lang. Sollen wir dann sagen, dass sie es trotz ihrer materiellen Natur schaffen, stets zur selben Zeit am selben Ort zu sein? Sollen wir sagen, dass beide gleich viel wiegen, aber zusammen nicht doppelt? Problem: Wenn man sagt, dass die beiden identisch sind, bekommt man Ärger mit den modalen Eigenschaften: Bsp Das Stück Lehm hätte auch ganz anders geformt sein können, die Statue aber nicht. Umgekehrt: I 56 Bsp Die Statue hätte aus Gold bestehen können, aber der Ton hätte nicht aus Gold bestehen können. Gegenstück Theorie/GT/Identität: Lösung: Die relevante Ähnlichkeitsrelation hängt davon ab, wie wir auf das Ding Bezug nehmen, als Statue oder als Lehm. Gegenstück Relation: Kann (anders als Identität) nicht nur vage und variabel, sondern auch asymmetrisch und intransitiv sein. (1968(1),28f): Das ist die Lösung für Def Chisholms Paradox/Schwarz: (Chisholm, 1967(2)): Bsp Angenommen, Kripke könnte unmöglich ein Rührei sein. Aber sicher könnte er ein wenig rühreiartiger sein, wenn er ein wenige kleiner und gelber wäre! Und wäre er ein bisschen mehr so, dann könnte er auch noch mehr so sein. Und es wäre seltsam, wenn er in jener Welt nicht wenigstens ein kleines bisschen kleiner und gelber sein könnte. GT/Lösung: Weil die Gegenstückrelation intransitiv ist, folgt aber keineswegs, dass am Ende Kripke ein Rührei ist. Ein Gegenstück eines Gegenstücks von Kripke muss nicht ein Gegenstück von Kripke sein (1986e(3), 246). I 57 KripkeVsGegenstück-Theorie/KripkeVsLewis: Bsp Wenn wir sagen „Humphrey hätte die Wahl gewinnen können“ reden wir nach Lewis eben nicht von Humphrey, sondern von jemand anderem. Und nichts könnte ihm gleichgültiger sein („he couldn’t care less“). (Kripke 1980(4), 44f). Gegenstück/Gegenstücktheorie/SchwarzVsKripke/SchwarzVsPlantinga: Die beiden Einwände missverstehen Lewis. Lewis behauptet nicht, dass Humphrey die Wahl nicht hätte Gewinnen können, im Gegenteil: „er hätte die Wahl Gewinnen können“ steht genau für die Eigenschaft, die jemand hat, wenn eins seiner Gegenstücke die Wahl Gewinnt. Diese Eigenschaft hat Humphrey, kraft seines Charakters (1983d(5),42). Eigentliches Problem: Wie macht Humphrey das, dass er in der und der möglichen Welt die Wahl Gewinnt? Plantinga: Humphrey hätte gewonnen, wenn der entsprechenden Welt (dem Sachverhalt) die Eigenschaft des Bestehens zukäme. Lewis/Schwarz: Diese Frage hat mit den Intuitionen auf die sich Kripke und Plantinga berufen, nichts zu tun. --- Schwarz I 223 Namen/Kennzeichnung/Referenz/Kripke/Putnam/Schwarz: (Kripke 1980(4), Putnam 1975(6)): These: Für Namen und Artausdrücke gibt es keine allgemeinbekannte Beschreibung (Kennzeichnung), die festlegt, worauf der Ausdruck sich bezieht. These: Kennzeichnungen sind für die Referenz völlig irrelevant. Beschreibungstheorie/LewisVsKripke/LewisVsPutnam/Schwarz: Das widerlegt nur die naive Kennzeichnungstheorie, nach der biographische Taten aufgelistet werden, die dem Referenten notwendig zukommen sollen. Lösung/Lewis: Seine Beschreibungstheorie der Namen erlaubt, dass Bsp „Gödel“ nur eine zentrale Komponente hat: nämlich dass Gödel am Anfang der Kausalkette steht. Damit steht die Theorie nicht mehr im Widerspruch zur Kausaltheorie der Referenz (1984b(7), 59, 1994b(8), 313, 1997c(9), 353f, Fn22). ((s)Vs: Aber nicht die Kennzeichnung „steht am Anfang der Kausalkette“, denn das unterscheidet einen Namen nicht von irgendeinem anderen. Andererseits: „Am Anfang der Gödel Kausalkette“ wäre nichtssagend.) Referenz/LewisVsMagische Theorie der Referenz: Nach dieser Theorie ist Referenz eine primitive, irreduzible Beziehung (vgl. Kripke 1980(4), 88 Fn 38), sodass wir, selbst wenn wir alle nicht semantischen Tatsachen über uns und die Welt wüssten, immer noch nicht wüssten, worauf unsere Wörter sich beziehen, nach der wir dazu spezielle Referenz-o-Meter bräuchten, die fundamentale semantische Tatsachen ans Licht bringen. Wenn die magische Theorie der Referenz falsch ist, dann genügt nicht semantische Information im Prinzip, um uns zu sagen, worauf wir uns mit Bsp „Gödel“ beziehen: "Wenn die Dinge so und so sind, bezieht sich „Gödel“ auf den und den". Daraus können wir dann eine Kennzeichnung konstruieren, von der wir a priori wissen, dass sie Gödel herausgreift. Diese Kennzeichnung wird oft indexikalische oder demonstrative Elemente enthalten, Verweise auf die wirkliche Welt. I 224 Referenz/Theorie/Namen/Kennzeichnung/Beschreibungstheorie/LewisVsPutnam/LewisVsKripke/Schwarz: Bsp unsere Bananen-Theorie sagt nicht, dass Bananen zu allen Zeiten und in allen möglichen Welten im Supermarkt verkauft werden. Bsp unsere Gödel-Theorie sagt nicht, dass Gödel in allen möglichen Welten Gödel heißt. ((s) >Deskriptivismus). (KripkeVsLewis: doch: Namen sind starre Designatoren). LewisVsKripke: Bei der Auswertung von Namen im Bereich von Temporal- und Modaloperatoren muss man berücksichtigen, was in der Äußerungssituation die Kennzeichnung erfüllt, nicht in der Welt oder in der Zeit, von der gerade die Rede ist (1970c(12), 87, 1984b(8), 59, 1997c(9), 356f). I 225 A posteriori Notwendigkeit/Kripke/Schwarz: Könnte es nicht sein, dass Wahrheiten über Schmerzen zwar auf physikalisch biologischen Tatsachen supervenieren und damit notwendig aus diesen folgen, dass uns diese Beziehung aber nicht a priori oder durch Begriffsanalyse zugänglich ist? Die Reduktion von Wasser auf H2O ist schließlich nicht philosophisch, sondern wissenschaftlich. Schwarz: Wenn das stimmt, macht sich Lewis die Arbeit unnötig schwer. Als Physikalist müsste er nur behaupten, dass phänomenale Begriffe in nicht phänomenalem Vokabular analysierbar sind. Man könnte auch die Analyse von Naturgesetzen und Kausalität sparen. Er könnte einfach behaupten, diese Phänomene folgten notwendig a posteriori aus der Verteilung lokaler physikalischer Eigenschaften. A posteriori notwendig/LewisVsKripke: Das ist inkohärent, dass ein Satz a posteriori ist, heißt, dass man Information über die aktuelle Situation braucht, um herauszufinden, ob er wahr ist. Bsp Dass Blair der tatsächliche Premierminister ist (tatsächlich eine a posteriori Notwendigkeit) muss man wissen, dass er in der aktuellen Situation Premierminister ist,.. I 226 ...was wiederum eine kontingente Tatsache ist. Wenn wir genügend Information über die ganze Welt haben, könnten wir im Prinzip a priori entnehmen, dass Blair der tatsächliche Premierminister ist. A posteriori Notwendigkeiten folgen a priori aus kontingenten Wahrheiten über die aktuelle Situation. (1994b(8), 296f, 2002b(10), Jackson 1998a(11): 56-86), s.o. 8.2) 1. David Lewis [1968]: “Counterpart Theory and Quantified Modal Logic”. Journal of Philosophy, 65:113–126. 2. Roderick Chisholm [1967]: “Identity through Possible Worlds: Some Questions”. Noˆus, 1:1–8. 3. David Lewis [1986e]: On the Plurality of Worlds. Malden (Mass.): Blackwell. 4. Saul A. Kripke [1980]: Naming and Necessity. Oxford: Blackwell. 5. David Lewis [1983d]: Philosophical Papers I . New York, Oxford: Oxford University Press. 6. Hilary Putnam [1975]: “The Meaning of ‘Meaning’ ”. In [Gunderson 1975], 131–193. 7. David Lewis [1984b]: “Putnam’s Paradox”. Australasian Journal of Philosophy, 61: 343–377. 8. David Lewis [1994b]: “Reduction of Mind”. In Samuel Guttenplan (Hg.), A Companion to the Philosophy of Mind, Oxford: Blackwell, 412–431. 9. David Lewis [1997c]: “Naming the Colours”. Australasian Journal of Philosophy, 75: 325–342. 10. David Lewis [2002b]: “Tharp’s Third Theorem”. Analysis, 62: 95–97. 11. Frank Jackson [1998a]: From Metaphysics to Ethics: A Defence of Conceptual Analysis. Oxford: Clarendon Press. 12. David Lewis [1970c]: “How to Define Theoretical Terms”. Journal of Philosophy, 67: 427–446. |
Lewis I David K. Lewis Die Identität von Körper und Geist Frankfurt 1989 Lewis I (a) David K. Lewis An Argument for the Identity Theory, in: Journal of Philosophy 63 (1966) In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis I (b) David K. Lewis Psychophysical and Theoretical Identifications, in: Australasian Journal of Philosophy 50 (1972) In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis I (c) David K. Lewis Mad Pain and Martian Pain, Readings in Philosophy of Psychology, Vol. 1, Ned Block (ed.) Harvard University Press, 1980 In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis II David K. Lewis "Languages and Language", in: K. Gunderson (Ed.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol. VII, Language, Mind, and Knowledge, Minneapolis 1975, pp. 3-35 In Handlung, Kommunikation, Bedeutung, Georg Meggle Frankfurt/M. 1979 Lewis IV David K. Lewis Philosophical Papers Bd I New York Oxford 1983 Lewis V David K. Lewis Philosophical Papers Bd II New York Oxford 1986 Lewis VI David K. Lewis Konventionen Berlin 1975 LewisCl Clarence Irving Lewis Collected Papers of Clarence Irving Lewis Stanford 1970 LewisCl I Clarence Irving Lewis Mind and the World Order: Outline of a Theory of Knowledge (Dover Books on Western Philosophy) 1991 Schw I W. Schwarz David Lewis Bielefeld 2005 |
| Gewinn Spiel | Kripke Vs Lewis, David | Lewis I 90/91 MöWe/mögliche Welt/Kripke/VsLewis/KripkeVsLewis: Wenn jemand verlangt, dass jede mögliche Welt auf rein qualitative Weise beschrieben werden muss, können wir nicht sagen "Angenommen, Nixon hätte die Wahl verloren" - wir müssen vielmehr eine Kennzeichnung anwenden: "angenommen, ein Mann, der einen Hund namens Checkers hat, der wie eine Verkörperung von David Frye aussieht, befindet sich in einer bestimmten möglichen Welt und verliert die Wahl." Ein Beispiel für diese Gegenstücktheorie (counterpart theory) ist David Lewis. MöWe/Lewis: Gegenstücke, nicht dieselben Leute - Kripke: dann geht es nicht um Identifizierung, sondern Ähnlichkeitsrelation. KripkeVsLewis: seine MöWe sind wie fremde Länder. Streng genommen ist seine Auffassung nicht eine Auffassung der "Identifizierung über mögliche Welt hinweg". Er ist vielmehr der Meinung, dass Ähnlichkeiten, die über mögliche Welten hinweg bestehen, eine Gegenstück-Relation bestimmen, die weder symmetrisch noch transitiv zu sein braucht. Das Gegenstück ist nie identisch mit diesen Gegenstand selbst. Wenn wir sagen "Humphrey hätte die Wahl Gewinnen können, wenn er was anderes getan hätte" dann reden wir also nicht über etwas, was Humphrey hätte geschehen können, sondern jemand anderem, einen "Gegenstück hätte geschehen können. KripkeVsLewis: seine Auffassung scheint mir noch bizarrer zu sein als die üblichen Begriffe der Identifizierung über mögliche Welt hinweg. Gegenstück/Lewis: Vertreter der Theorien, dass eine mögliche Welt uns nur qualitativ gegeben ist ("Gegenstück-Theorie", David Lewis) argumentieren, dass Aristoteles, bzw. seine Gegenstücke "in anderen möglichen Welten" mit denjenigen Dingen "zu identifizieren" ist, die Aristoteles in seinen wichtigsten Eigenschaften am stärksten ähneln. KripkeVsLewis: Aristoteles’ wichtigste Eigenschaften liegen in seinen Werken, Hitlers in seiner mörderischen politischen Rolle. Doch könnten beide gelebt haben, ohne diese Eigenschaften überhaupt gehabt zu haben. Es hängt kein logisches Schicksal über ihnen, dass es in irgendeiner Hinsicht unvermeidlich macht, dass sie die diejenigen Eigenschaften besitzen sollten, die nach unserer Ansicht wichtig für sie sind. Wichtige Eigenschaften brauchen keine wesentlichen zu sein. I 181 Gegenstück/Lewis: qualitativ bestimmt - KripkeVs: MöWe nicht qualitativ bestimmt, sondern festgesetzt. Lewis V XIII KripkeVsLewis: Bsp eine runde Scheibe aus homogenem Material: die Frage, ob die Scheibe sich dreht oder nicht, ist eine Eigenschaft der Welt, die nicht auf dem Arrangement von Qualitäten (AvQ) superveniert! Wir könnten zwei mögliche Welten haben, eine mit einer sich drehenden und eine mit einer ruhenden Scheibe, und das Arrangement von Qualitäten wäre genau das gleiche. |
Kripke I S.A. Kripke Name und Notwendigkeit Frankfurt 1981 Kripke II Saul A. Kripke "Speaker’s Reference and Semantic Reference", in: Midwest Studies in Philosophy 2 (1977) 255-276 In Eigennamen, Ursula Wolf Frankfurt/M. 1993 Kripke III Saul A. Kripke Is there a problem with substitutional quantification? In Truth and Meaning, G. Evans/J McDowell Oxford 1976 Kripke IV S. A. Kripke Outline of a Theory of Truth (1975) In Recent Essays on Truth and the Liar Paradox, R. L. Martin (Hg) Oxford/NY 1984 Lewis I David K. Lewis Die Identität von Körper und Geist Frankfurt 1989 Lewis I (a) David K. Lewis An Argument for the Identity Theory, in: Journal of Philosophy 63 (1966) In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis I (b) David K. Lewis Psychophysical and Theoretical Identifications, in: Australasian Journal of Philosophy 50 (1972) In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis I (c) David K. Lewis Mad Pain and Martian Pain, Readings in Philosophy of Psychology, Vol. 1, Ned Block (ed.) Harvard University Press, 1980 In Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989 Lewis II David K. Lewis "Languages and Language", in: K. Gunderson (Ed.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol. VII, Language, Mind, and Knowledge, Minneapolis 1975, pp. 3-35 In Handlung, Kommunikation, Bedeutung, Georg Meggle Frankfurt/M. 1979 Lewis IV David K. Lewis Philosophical Papers Bd I New York Oxford 1983 Lewis V David K. Lewis Philosophical Papers Bd II New York Oxford 1986 Lewis VI David K. Lewis Konventionen Berlin 1975 LewisCl Clarence Irving Lewis Collected Papers of Clarence Irving Lewis Stanford 1970 LewisCl I Clarence Irving Lewis Mind and the World Order: Outline of a Theory of Knowledge (Dover Books on Western Philosophy) 1991 |
| Gewinn Spiel | Quine Vs Lewis, David | II 15 Mögliche Welten/MöWe/Quine: Die meisten Verfahren sind körperorientiert, sie betreffen nicht den Begriff der Identität, sondern den des Körpers. Die meisten Prädikate bezeichnen Körper, leiten ihre Individuation davon her - Moment-zu-Moment-Identifikation. Das Dollarbeispiel wirkt recht forciert Wir setzen der hartnäckigen Körperfixierung unsere liberalere Ontologie der phys. Geg. entgegen. Alle Geg. bilden Werte meiner Variablen (bei Quantifikation). II 158 Und was wären die analogen Werte in anderen Welten? Schlicht die Summen der physikalischen Geg. in allen MöWe, wobei die Bewohner unterschiedslos verbunden werden. Bsp Einer dieser Werte wäre "Napoleon mitsamt seinen Gegenstücken in anderen Welten" ein anderer bestünde aus Napoleon mitsamt diversen völlig verschiedenen unähnlichen Bewohnern anderer Welten. Daher verlangt die Quantifikation über Gegenstände quer durch MöWe keineswegs, dass wir dem Ausdruck "Gegenstück" irgendeinen Sinn abGewinnen! Ebenso wie beliebige Momentangegenstände zu verschiedenen Zeiten Zeitsegmente bilden, die nicht nur einem, sondern zahllosen zeitlich ausgedehnten Gegenstanden angehören.(QuineVsLewis). Die Quantifikation über einen Bereich ist nicht schwieriger als über mehrere Bereiche, wenn es nicht zusätzliche Schwierigkeiten mit Bezug auf MöWe gibt. Die gibt es in der Tat: nicht in der Quantifikation sondern in den Prädikaten. |
Quine I W.V.O. Quine Wort und Gegenstand Stuttgart 1980 Quine II W.V.O. Quine Theorien und Dinge Frankfurt 1985 Quine III W.V.O. Quine Grundzüge der Logik Frankfurt 1978 Quine V W.V.O. Quine Die Wurzeln der Referenz Frankfurt 1989 Quine VI W.V.O. Quine Unterwegs zur Wahrheit Paderborn 1995 Quine VII W.V.O. Quine From a logical point of view Cambridge, Mass. 1953 Quine VII (a) W. V. A. Quine On what there is In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (b) W. V. A. Quine Two dogmas of empiricism In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (c) W. V. A. Quine The problem of meaning in linguistics In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (d) W. V. A. Quine Identity, ostension and hypostasis In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (e) W. V. A. Quine New foundations for mathematical logic In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (f) W. V. A. Quine Logic and the reification of universals In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (g) W. V. A. Quine Notes on the theory of reference In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (h) W. V. A. Quine Reference and modality In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VII (i) W. V. A. Quine Meaning and existential inference In From a Logical Point of View, Cambridge, MA 1953 Quine VIII W.V.O. Quine Bezeichnung und Referenz In Zur Philosophie der idealen Sprache, J. Sinnreich (Hg) München 1982 Quine IX W.V.O. Quine Mengenlehre und ihre Logik Wiesbaden 1967 Quine X W.V.O. Quine Philosophie der Logik Bamberg 2005 Quine XII W.V.O. Quine Ontologische Relativität Frankfurt 2003 Quine XIII Willard Van Orman Quine Quiddities Cambridge/London 1987 |
| Gewinn Spiel | Mackie Vs Pascal, B. | Stegmüller IV 481 Pascalsche Wette/Pascal/Stegmüller: wir wissen, dass Gott existiert oder nicht existiert. Aber unsere theoretische Vernunft kann nicht entscheiden. Sich einfach des Urteils enthalten kann man auch nicht, man muss sich festlegen. Möglicher Gewinn: Seligkeit und Erkenntnis der Wahrheit. Was wir riskieren sind Irrtum und Elend. Der Wetteinsatz sind Vernunft und Wille. Welche Wahl wir auch treffen, wir werden in keinem Fall der Vernunft Gewalt antun. IV 482 Anders verhält es sich mit der Seligkeit: man verliert im Falle von Gottes Nichtexistenz nichts, hat allerdings auch nichts gewonnen. Daher spricht die praktische Vernunft für Gott. Pascal fügt hinzu: allerdings könnte man sein irdisches Glück verlieren (wenn es in Prasserei besteht) aber der Vergleich zur ewigen Glückseligkeit spricht für letztere. Man braucht nicht davon auszugehen, dass die Wahrscheinlichkeit für Existenz oder Nichtexistenz gleich groß sind! Selbst wenn die Ungleichheit gegen unendlich geht spricht alles für den Einsatz zugunsten der Existenz. ((s) >egalitäre/inegalitäre Theorien/Nozick). Mackie gibt in seinem Buch eine Tabelle der Wahrscheinlichkeitsverteilung an. IV 483 VsPascal: was soll es eigentlich heißen, auf einer solchen Grundlage etwas zu glauben? Vielleicht ist jemand einfach unfähig, an Gott zu glauben? Glauben/Stegmüller: man kann nicht willentlich an etwas glauben. Pascal: aber vielleicht steckt der Hinderungsgrund irgendwo im Gemüt, darauf kann man einwirken. Man kann sich entschließen, den Glauben zu praktizieren! Indirekt willentlich. MackieVsPascal: 1. Widerspruch gegen seine eigene Behauptung, dass die Wette der Vernunft keine Gewalt antue: wer sich so zum Glauben bringt, tut allerdings seiner Vernunft und seinem Einsichtsvermögen Gewalt an. 2. Wer sich gegen unendliche Unwahrscheinlichkeit entscheidet, verwirft allerdings sehr wohl seine Vernunftprinzipien! IV 484 3. Pascals weitere Voraussetzungen kommen ins Spiel: die Prädestinationslehre könnte ja richtig sein, in dem Fall sollte jeder danach trachten, sein irdisches Leben so glücklich wie möglich zu gestalten. Außerdem steckt hinter der Wette ein äußerst primitives Gottesbild: ein dummer und eitler Gott. 4. Selbst wenn es einen solchen Gott geben sollte, wäre dieser vielleicht gar nicht mit dem Glauben an ihn zufrieden sondern forderte eine Kirche usw. |
Macki I J. L. Mackie Ethics: Inventing Right and Wrong 1977 |
| Gewinn Spiel | Millikan Vs Quine, W.V.O. | I 215 beschreibend/referentiell/Kennzeichnung/Klassifikation/Millikan: man kann erzwingen, dass eine beschreibende Kennzeichnung referentiell funktioniert, Bsp „Er sagte, dass der Gewinner der Verlierer war“. Bsp (Russell): „Ich dachte, deine Yacht wäre größer als sie ist“. I 216 Lösung: „der Gewinner“, und „größer als deine Yacht“ müssen als nach dem angepassten (adaptierten) Sinn klassifiziert angesehen werden. Dagegen: „Der Verlierer“: hat wahrscheinlich nur beschreibenden Sinn- „Deine Yacht“: wird durch beides klassifiziert: durch angepassten und durch relationalen Sinn, nur „dein“ ist rein referentiell. Quine: (klassisches BeiSpiel) Bsp „Phillip glaubt, dass die Hauptstadt von Honduras in Nicaragua liegt“. MillikanVsQuine: das ist nicht, wie Quine glaubt, offensichtlich falsch. Es kann als wahr gelesen werden, wenn „Hauptstadt von Honduras“ relationalen Sinn in diesem Kontext hat. referentiell/beschreibend/Glaubenszuschreibung/intentional/Millikan: es gibt Ausnahmen, wo die Ausdrücke nicht beschreibend, aber auch nicht rein referentiell funktionieren, sondern auch durch relationalen Sinn oder Intension. Bsp „der Mann der uns nach Hause fuhr“ sei jemand, der Sprecher und Hörer sehr gut bekannt ist. Dann muss der Hörer annehmen, dass hier jemand anderes gemeint ist, weil der Name nicht gebraucht wird. Regel: hier wird die zweite Hälfte der Regel für intentionale Kontexte verletzt, „setzte welchen Ausdruck auch immer ein, der die Referenz erhält“. Das ist oft ein Zeichen dafür, dass die erste Hälfte verletzt ist: „ein Zeichen hat nicht nur Referenz, sondern auch Sinn oder Intension, die erhalten werden müssen. Warum sollte man sonst eine so umständliche Kennzeichnung („der Mann der uns nach Hause fuhr“) gebrauchen, statt des Namens? Ortcutt/Ralph/Spion/Quine/Millikan: Bsp es gibt einen Mann mit braunem Hut, den Ralph flüchtig gesehen hat. Ralph nimmt an, er ist ein Spion. a) Ralph glaubt, dass der Mann den er flüchtig gesehen hat, ein Spion ist. I 217 b) Ralph glaubt, der Mann mit dem braunen Hut ein Spion ist Millikan: die unterstrichenen Teile werden relational aufgefasst, b) ist fraglicher als a) weil nicht klar ist, ob Ralph in explizit als einen braunen Hut tragend wahrgenommen hat. Quine: Außerdem ist da ein grauhaariger Mann, den Ralph vage als Säule der Gesellschaft kennt und von dem ihm nicht bewusst ist ihn gesehen zu haben, außer einmal am Strand. c) Ralph glaubt, dass der Mann, den er am Strand gesehen hat, ein Spion ist. Millikan: das ist sicher relational. Als solches wird es nicht aus a) oder b) folgen. Quine: führt jetzt erst an, dass Ralph es nicht weiß, aber die zwei Männer sind ein und derselbe. d) Ralph glaubt, dass der Mann mit dem braunen Hut kein Spion ist. Das ist jetzt einfach falsch. Frage: was ist aber mit e) Ralph glaubt, dass Ortcutt ein Spion ist f) Ralph glaubt, dass Ortcutt kein Spion ist. Quine: jetzt erst teilt uns Quine nämlich den Namen des Mannes mit (der Ralph unbekannt ist). Millikan: Bsp Jennifer, eine bekannte von Samuel Clemens, weiß nicht, dass dieser Mark Twain ist. I 218 Sie sagt: „Ich würde sehr gern Mark Twain treffen“ und nicht „ich würde sehr gern Samuel Clemens treffen“. sprach-abhängig: hier wird „Mark Twain“ sprach-abhängig klassifiziert. Also sind auch sprachgebundene Intensionen nicht immer irrelevant für intentionale Kontexte. Sprach-gebunden musste das hier sein, um deutlich zu machen, dass der Name selbst wesentlich ist und gleichzeitig, dass es sinnlos ist zu unterstellen, dass sie gesagt hätte, sie wolle Samuel Clemens treffen. Ralph/Quine/Millikan: Quine geht davon aus, dass Ralph nicht nur zwei innere Namen für Ortcutt hat, aber nur einer von beiden ist an den äußeren Nehmen Ortcutt geknüpft. Millikan: Variante: Bsp’ ‚ Sie und ich beobachten Ralph, der misstrauisch Ortcutt beobachtet, der mit einer Kamera hinter dem Busch steht (sicher will er nur Spinnweben fotografieren). Ralph hat Ortcutt nicht als diesen erkannt und Sie denken: Gute Güte, Ralph glaubt, dass Ortcutt ein Spion ist“. Pointe: in diesem Kontext ist der Satz wahr! ((s) Weil der Name „Ortcutt“ von uns verliehen wurde, nicht von Ralph). referentiell/Millikan: Lösung: „Ortcutt“ wird hier als referentiell klassifiziert. referentiell/Millikan. Bsp „Letzten Halloween dachte Susi tatsächlich, Robert (ihr Bruder) wäre ein Geist“. ((s) sie dachte nicht von Robert und auch nicht von ihrem Bruder, dass er ein Geist wäre, sondern dass sie einen Geist vor sich hätte). MillikanVsQuine: so lange wie noch niemand explizit gefragt oder verneint hat, dass Tom weiß, dass Cicero Tullius ist, sind die zwei Glaubenszuschreibungen „Tom glaubt, dass Cicero Catilina denunziert hat“ und „…Tullius…“ äquivalent! sprach-gebundene Intension/Millikan: wird nur erhalten, wenn der Kontext klarmacht, welche Worte gebraucht wurden, oder welche öffentlichen Wörter der Glaubende als implizite Intensionen hat. voll-entwickelte (sprach-unabhängige) Intension/Millikan: für sie gilt das gleiche, wenn sie absichtlich bewahrt werden: I 219 Bsp „Die Eingeborenen glauben, dass Hesperus ein Gott und Phosphorus ein Teufel ist“. Aber: Pointe: es geht darum, dass die Eigenfunktion eines Satzes erhalten bleiben muss, wenn man in intentionale Kontexte übergeht. Das ist der Grund dafür, dass man bei der Glaubenszuschreibung nicht einfach „Cicero ist Tullius“ durch „Cicero ist Cicero“ ersetzen kann. ((s) triviale/nicht-triviale Identität). Stabilisierungsfunktion/SF/Identitätsaussage/Millikan: die SF ist es, dass der Hörer „A“ und „B“ in denselben inneren Term übersetzt. Deswegen ist die Eigenfunktion (EF) von „Cicero ist Cicero“ eine andere als die von „Cicero ist Tullius“. Weil die EF verschieden ist, kann das eine nicht für das andere eingesetzt werden, in intentionalen Kontexten. Eigenfunktion: Bsp „Ortcutt ist ein Spion und kein Spion“: hat die EF, in einen inneren Satz übersetzt zu werden, der ein Subjekt und zwei Prädikate hat. Kein Satz dieser Form ist in Ralphs Kopf zu finden. Deshalb kann man nicht sagen, dass Ralph glaubt, dass Ortcutt ein Spion und kein Spion ist. I 299 Nichtwiderspruch/Millikan: der Test auf sie ist gleichzeitig ein Test auf unsere Fähigkeit, etwas zu identifizieren, wie auch darauf, dass unsere Begriffe das abbilden, was sie abbilden sollen. MillikanVsQuine: dabei geht es aber nicht „Bedingungen für Identität“ aufzustellen. Und auch nicht um „geteilten Bezug“ („derselbe Apfel wieder“). Das gehört zum Problem der Einheitlichkeit, nicht der Identität. Das ist nicht das Problem zu entscheiden, wie eine Ausschließlichkeitsklasse aufgeteilt wird. I 300 Bsp zu entscheiden, wann rot aufhört und orange anfängt. Statt dessen geht es darum zu lernen, Bsp rot unter anderen Umständen wiederzuerkennen. Wahrheit/Richtigkeit/Kriterium/Quine/Millikan. für Quine scheint ein Kriterium für richtiges Denken zu sein, dass die Relation auf einen Reiz vorhergesagt werden kann. MillikanVsQuine: aber wie soll das lernen, unisono zu sprechen, die Vorhersage erleichtern? Übereinstimmung/MillikanVsQuine/MillikanVsWittgenstein: beide berücksichtigen nicht, was Übereinstimmung in Urteilen eigentlich ist: es ist nicht unisono zu reden., Wenn man nicht dasselbe sagt, heißt das nicht, dass man nicht übereinstimmt. Lösung/Millikan: Übereinstimmung heißt, dasselbe über dasselbe zu sagen. Nichtübereinstimmung: kann nur entstehen, wenn Sätze Subjekt-Prädikat-Struktur haben und Negation zugelassen ist. Ein-Wort-Satz/QuineVsFrege/Millikan: Quine geht sogar soweit, „Autsch!“ als Satz zuzulassen. Er meint, der Unterschied zwischen Wort und Satz betrifft am Ende nur den Drucker. Negation/Millikan: die Negation eines Satzes wird nicht durch die Abwesenheit von Belegen bewiesen, sondern durch positive Tatsachen (s.o.). Widerspruch/Millikan: dass wir nicht einem Satz und seiner Negation gleichzeitig zustimmen, liegt in der Natur (Naturnotwendigkeit). I 309 These: Mangel an Widerspruch basiert wesentlich auf der ontologischen Struktur der Welt. Übereinstimmung/MillikanVsWittgenstein/MillikanVsQuine/Millikan: beide sehen nicht die Wichtigkeit der Subjekt-Prädikat-Struktur mit Negation. Daher verkennen sie die Wichtigkeit der Übereinstimmung im Urteil. Übereinstimmung: dabei geht es nicht darum, dass zwei Leute zusammenkommen, sondern dass sie mit der Welt zusammenkommen. Übereinstimmung/Nichtübereinstimmung/Millikan: sind nicht zwei gleichwahrscheinliche Möglichkeiten ((s) Vgl. >Inegalitäre Theorie/Nozick). Es gibt viel mehr Möglichkeiten für einen Satz falsch zu sein, als für denselben Satz, wahr zu sein. Wenn nun ein ganzes Muster (System) übereinstimmender Urteile auftaucht, die denselben Bereich abbilden (z.B. Farbe) ist die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Teilnehmer einen Bereich draußen in der Welt abbildet, überwältigend. ((s) ja - aber noch nicht, dass sie dasselbe meinen). Bsp nur weil meine Urteile über den Zeitablauf fast immer mit denen anderer übereinstimmen, habe ich Grund zu glauben, dass ich die Fähigkeit habe, meine Erinnerungen richtig in den Zeitablauf einzuordnen. Objektivität/Zeit/Perspektive/Medium/Kommunikation/Millikan: These: das Medium, das andere Personen mit ihren Äußerungen bilden, ist für mich die am besten zugängliche Perspektive, die ich im Hinblick auf die Zeit haben kann. I 312 Begriff/Gesetz/Theorie/Test/Überprüfung/Millikan: wenn ein Begriff in einem Gesetz vorkommt ist es notwendig, I 313 ihn zusammen mit anderen Begriffen zu testen. Verknüpft sind diese Begriffe nach gewissen Schlussregeln. Begriff/Millikan: dass Begriffe aus Intensionen bestehen, sind es die Intensionen, die getestet werden müssen. Test: heißt aber nicht, dass das Vorkommen von Sinnesdaten vorausgesagt würde. (MillikanVsQuine). Sinnesdatentheorie/heute/Millikan. die vorherrschende Sicht scheint zu sein, These: dass weder eine innere noch eine äußere Sprache tatsächlich Sinnesdaten beschreibt, außer, dass die Sprache von vorausgehenden Begriffen äußerer Dinge abhängt, die Normalerweise Sinnesdaten verursachen. I 314 Vorhersage/Voraussage/voraussagen/Prognose/MillikanVsQuine/Millikan: wir bilden die Welt ab, um sie zu bewohnen, nicht um sie vorherzusagen. Wenn Voraussagen nützlich sind, so doch nicht von Erlebnissen an unseren Nervenenden. Bestätigung/Voraussage/Millikan: ein Wahrnehmungsurteil impliziert vor allem sich selbst. Bsp wenn ich verifizieren möchte, dass dieser Behälter einen Liter fasst, muss ich nicht voraussagen können, dass die einzelnen Kanten eine bestimmte Länge haben. D.h. ich muss keine bestimmten Sinnesdaten vorhersagen können. I 317 Theorie/Überprüfung/Test/MillikanVsQuine/Millikan: ist es wirklich wahr, dass alle Begriffe zusammen getestet werden müssen? Tradition: sagt, dass nicht nur einige, sondern die meisten unserer Begriffe nicht von Dingen sind, die wir direkt beobachten sondern von anderen Dingen. Test/logische Form/Millikan: wenn es ein Ding A gibt, ds identifiziert wird, indem Effekte auf B und C beobachtet werden, wird dann nicht die Gültigkeit der Begriffe von B und C zusammen mit der Theorie, die die beobachteten Effekte auf den Einfluss von A zurückführt, zusammen mit dem Begriff von A getestet? Millikan. Nein! Aus der Tatsache, dass meine Intension von A auf Intensionen von B und C zurückgeht folgt nicht, dass die Gültigkeit der Begriffe, die B und C regieren, getestet wird, wenn der Begriff, der A regiert, getestet wird und umgekehrt auch nicht. Und zwar folgt es nicht, wenn A eine bestimmte Kennzeichnung ist Bsp „der erste Präsident der USA“ und es folgt auch nicht, wenn die explizite Intension von A etwas kausal Abhängiges repräsentiert Bsp „das Quecksilber in dem Thermometer hier stieg auf die Marke 70“ als Intension für „die Temperatur betrug 70 Grad“. I 318 Begriff/Millikan; Begriffe sind Fähigkeiten – und zwar die Fähigkeit etwas als selbstidentisch zu erkennen. Test/Überprüfung: die Überprüfungen der Gültigkeit meiner Begriffe sind ganz unabhängig voneinander: Bsp meine Fähigkeit, einen guten Kuchen zu machen ist ganz unabhängig von meiner Fähigkeit Eier zu zerschlagen, auch wenn ich Eier zerschlagen muss, um den Kuchen zu machen. Objektivität/objektive Realität/Welt/Methode/Wissen/Millikan: wir erhalten ein Wissen über die Außenwelt, indem wir verschiedene Methoden anwenden um ein Ergebnis zu erhalten. Bsp verschiedene Methoden der Temperaturmessung: So kommen wir zu der Auffassung, dass Temperatur etwas Reales ist. I 321 Wissen/Zusammenhang/Holismus/Quine/MillikanVsQuine/Millikan: hängt nicht alles Wissen von „kollateraler Information“ ab, wie Quine sie nennt? Wenn alle Wahrnehmung mit allgemeinen Theorien verwoben ist, wie können wir dann einzelne Begriffe unabhängig vom Rest testen? Two Dogmas/Quine/Millikan. These: ~ „unsere Feststellungen über die äußere Welt stehen nicht einzeln vor dem Tribunal der Erfahrung, sondern nur als Korpus“. Daraus folgt: keine einzelne Überzeugung ist immun gegen Korrektur. Test/Überprüfung/MillikanVsHolismus/MillikanVsQuine/Millikan: die meisten unserer Überzeugungen stehen niemals vor dem Tribunal der Erfahrung. I 322 Daher ist es unwahrscheinlich, dass eine solche Überzeugung jemals durch andere Überzeugungen gestützt oder widerlegt wird. Bestätigung: einzige Bestätigung: durch meine Fähigkeit, die Gegenstände wiederzuerkennen, die in meinen Einstellungen vorkommen. Daraus, dass Überzeugungen zusammenhängen folgt nicht, dass die Begriffe ebenso zusammenhängen müssen. Identität/Identifikation/Millikan. die Erkenntnistheorie der Identität ist vorrangig vor der der Urteile. |
Millikan I R. G. Millikan Language, Thought, and Other Biological Categories: New Foundations for Realism Cambridge 1987 Millikan II Ruth Millikan "Varieties of Purposive Behavior", in: Anthropomorphism, Anecdotes, and Animals, R. W. Mitchell, N. S. Thomspon and H. L. Miles (Eds.) Albany 1997, pp. 189-1967 In Der Geist der Tiere, D Perler/M. Wild Frankfurt/M. 2005 |
| Gewinn Spiel | Fraassen Vs Sellars, W. | I 32 empirische Gesetze/Sellars: haben wir gar nicht! Bsp dass Wasser bei 100° kocht gilt nur, wenn der Druck normal ist. (>Cartwright). Fraassen: das ist soweit nur methodisch, denn wir haben gar kein Zutrauen in die Verallgemeinerungen unserer alltäglichen Erfahrungen. Problem: wir erwarten aber von einer Theorie, die Mikrostruktur (MiSt) (theoretische Entitäten) postuliert, dass sie tatsächliche universelle Regularitäten zeigt. FraassenVsSellars/FraassenVsRealismus: damit wird eine unbeobachtbare Realität hinter den Phänomenen postuliert. Bsp Angenommen, in einem frühen Stadium der Chemie entdeckte man, dass verschiedene Proben von Gold sich verschieden schnell in aqua regia auflösten. Aber die Proben waren beobachtungsmäßig identisch. I 33 Lösung: (damals): man postulierte für die zwei Proben verschiedene Mikrostruktur (MiSt). Dann wurde die Variation damit erklärt, dass die Proben Mischungen dieser zwei (beobachtungsmäßig identischen) Substanzen seien. Damit haben die Gesetze kein beobachtungsmäßiges Gegenstück. Ohne das scheint keine Erklärung möglich. Und diese ist das Ziel der Wissenschaft, also müssen wir an eine unbeobachtbare MiSt glauben. Das führt zu drei Fragen: 1. hat die Postulierung der MiSt wirklich neue Konsequenzen für die beobachtbaren Phänomene? 2. Muss Wissenschaft wirklich immer Erklärungen liefern? 3. könnte es ein anderes Grundprinzip (rationale) für den Gebrauch des Bildes der MiSt in der Entwicklung von Theorien geben? FraassenVsSellars: Ad 1.: es scheint dass diese hypothetischen Chemiker sehr wohl neue beobachtbare Regularitäten postulierten: Angenommen, zwei Substanzen A und B mit Auflösungsraten x und x+y. Jede Goldprobe ist eine Mischung aus den zwei Substanzen,. Dann folgt, dass jede Probe sich auflöst mit einer Rate zwischen x und x+y. Und das ist noch nicht dadurch impliziert, dass verschiedene Proben sich in der Vergangenheit in diesem Spielraum aufgelöst haben. Damit ist Sellars im 1. Punkt widerlegt. Angenommen, (um Sellars’ Argument willen) es gibt immer noch keine Möglichkeit, die Auflösungsraten genauer vorherzusagen. Brauchen wir dann kategorisch eine Erklärung, die sich nicht auf Beobachtbares stützt? (Das war Reichenbachs PdgU oder die Forderung nach der Existenz verborgener Parameter). verborgene Parameter/Sellars: erkennt klar, dass das der gegenwärtigen QM zuwiderlaufen würde, entsprechend sagt er, dass ihre mathematischen Modelle damit inkompatibel sind. I 34 Also beschränkt er sich auf die Fälle, wo es konsistent ist, verborgene Variablen anzunehmen. Konsistenz/Fraassen: ist natürlich ein logischer Haltepunkt. FraassenVsverborgene Variablen/FraassenVsSellars: das verhindert nicht die Katastrophe: obwohl es einige Beweise gibt, dass verborgene Variablen nicht in eine klassische deterministische Theorie eingeführt werden können, verlangen diese Beweise etwas viel stärkeres als Konsistenz: Bsp die Annahme, dass zwei verschiedene physikalische Variablen nicht dieselbe Wschk-Verteilung in der Messung über alle möglichen Zustände haben können. Also, wenn wir nicht Unterschiede in der Vorhersage für Beobachtbares angeben können, gibt es keinen wirklichen Unterschied. (Keine Unterscheidung ohne Unterschied. Stärkere Forderung als Konsistenz stärker/schwächer). Ad. 3. wie kann der Anti-Realismus dem Sinn abGewinnen? Abgesehen von den tatsächlich neuen empirischen Konsequenzen (s.o.) wird er methodische Gründe anführen. Mit der Annahme einer bestimmten MiSt könnten wir zu neuen Implikationen über empirische Regularitäten gelangen. Das ist natürlich nur eine Hoffnung. Aber: Wissenschaft/Fraassen: These: ihr geht es nicht um Erklärung als solche, sondern um neue Aussagen über beobachtbare Regularitäten. I 30 FraassenVsverborgene Parameter: wenn das empirisch äquivalent mit der orthodoxen QM ist, führt es zu nicht-logischen Korrelation nicht-klassischer Art, die immer noch das PdgU verletzen würden. Aber auch diese Frage ist akademisch, denn die moderne Physik braucht keine verborgenen Parameter. |
Fr I B. van Fraassen The Scientific Image Oxford 1980 |
| Gewinn Spiel | Verschiedene Vs Vollmer, G. | Putnam I 196 Kausalität/Charles FriedVsVollmer: kann man leicht für eine physikalische Beziehung halten! Bsp "Handeln, zerschlagen, bewegen" sind kausale Verben. (Impulsübertragung). Fried: sobald man diesen Fehler gemacht hat, fällt es leicht zu glauben, dass funktionale Eigenschaften ganz einfach physikalische Zustände höherer Stufe wären. (Putnam Selbstkritik: habe ich selbst früher geglaubt) und dann zu denken, Referenz (und überhaupt so ziemlich alles) könnte eine funktionale Eigenschaft und also physikalisch sein. I 275 VsEvolutionäre Erkenntnistheorie/EE: Anpassung ist wechselseitig Es ist gerade der Selektionsvorteil des Menschen, seine Umwelt radikal umgestalten (in Bezug auf seine Bedürfnisse) zu können. So wird in der EE gerade das konstruktive Moment ausgeklammert. VollmerVsVs: die EE ist von Biologen entwickelt worden, die sich der Wechselwirkung der Anpassung durchaus bewusst sind. Die Dynamik des Prozesses beeinträchtigt die Anwendbarkeit des Begriff der Anpassung aber überhaupt nicht. (DennettvsAnpassung, GouldVsAnpassung). I 290 DretskeVsEvolutionäre Erkenntnistheorie: hat sehr wenig zu bieten. (1971,585) PutnamVsEvolutionäre Erkenntnistheorie: ist vielleicht nicht wissenschaftlich falsch, beantwortet aber keine einzige philosophische Frage! (1982a,6) I 292 VsEE: einige ihrer Vertreter sehen schon in der gesamten biologischen Evolution einen "erkenntnisgewinnenden Prozess". so wird schon der Amöbe Erkenntnis zugeschrieben. Oder man spricht davon, dass ein Molekül ein anderes "erkenne". I 293 VollmerVsVs: kein Kritiker definiert "Erkenntnis", allein Löw: dazu gehöre Subjektivität (die er aber auch nicht definiert). Information/Löw: Information gibt es immer nur für ein Subjekt". Vollmer pro, aber vielleicht zu dogmatisch. I 298 Wahrheit/Erfolg/VsEE: wenn die Richtigkeit von Erfahrung aus evolutionärem Erfolg geschlossen wird, wird: 1. Fakten mit Normen verwechselt (quid juris, quid facti) 2. Das Erkenntnisproblem auf seinen genetischen Kontext reduziert und damit 3. Die Frage nach der Gültigkeit einer Aussage trivialisiert. Das ist ein "genetischer Fehlschluss". VollmerVsVs: es ist zwar richtig, dass faktische und normative Fragen hier für untrennbar erachtet werden, d.h. aber nicht, dass sie verwechselt werden! Die EE schließt nicht vom Überleben auf die Richtigkeit eines Weltbildes! Vielmehr umgekehrt: im allgemeinen deutet eine bessere Erfassung der Außenweltstrukturen auf einen Überlebensvorteil. Unter Konkurrenz setzt sich dann meistens das bessere Weltbild durch I 300 Geltung/VsEE: Die EE löse das Geltungsproblem nicht. Geltung ist für Erkenntnis zentral, aber nicht ohne Reflexion möglich. Geltung/Vollmer: was Geltung ist, wird sehr unterschiedlich gesehen. Lotze: Triftigkeit Puntel: diskursive Einlösbarkeit Gethmann: Zustimmungsfähigkeit. Allgemein notwendig: eine geltende Aussage muss syntaktisch korrekt, logisch konsistent, semantisch einwandfrei, intersubjektiv verständlich, diskursfähig, intersubjektiv nachprüfbar, mit anerkannten Aussagen verträglich, usw. hinreichend: hier muss man zwischen bedingter (hypothetischer) und unbedingter (kategorischer) Geltung unterscheiden. Bedingte Geltung: hat eine Aussage, wenn für den Nachweis ihrer Geltung eine andere Aussage als gültig vorausgesetzt werden muss, andernfalls unbedingte Geltung. Vollmer: der Anspruch unbedingter Geltung ist noch niemals eingelöst worden. (> Letztbegründung). Wir müssen uns mit Bedingungen für relative Geltung begnügen. I 309 VsEE: wenn die Erkenntnistheorie empirisch ist, wird sie zirkulär I 310 EE/Vollmer: es ist nicht die Aufgabe der Erkenntnistheorie, absolute Rechtfertigungen für Erkenntnis und Wahrheitsansprüche zu liefern. Man kann aber fragen, unter welchen Bedingungen sicheres faktisches Wissen möglich wäre, und auf diese Fragen kann sie auch vernünftige Antworten geben. Erkenntnistheorie/Vollmer: Aufgaben: Explikation von Begriffen und Wissen Untersuchung unserer kognitiven Fähigkeiten, Vergleich verschiedener kognitiver Systeme Unterscheidung subjektiver und objektiver Strukturen, deskriptiver und normativer Aussagen, faktischer und konventioneller Elemente Erhellung der Bedingungen für Erkenntnis Aufweis von Erkenntnisgrenzen. I 315 Kausalität/VsEE: nach der EE spielt die Kausalität eine dreifache Rolle: 1. Ordnungsform der Natur 2. Denkkategorie 3. diese Denkkategorie ist durch Selektion entstanden. Also erzeugt letztlich Kausalität über Kausalität Kausalität. a) Durch die Mehrfachbedeutung von "Kausalität" wird das Prinzip der methodischen Ordnung verletzt. (Gerhardt, 1983,67 69,75). b) Wenn Kausalität eine Denkkategorie ist, kann sie nicht zugleich ein Erfahrungsprodukt sein. Dazu müsste sie nämlich wie jede Erfahrung induktiv oder abstraktiv sein. Also müssten solche Ereignisfolgen zunächst einmal als kausal erkannt worden sein. (Lütterfelds,1982, 113,6). I 316 VollmerVsVs: die Mehrdeutigkeit ist zuzugeben, aber leicht zu beseitigen. Lösung: man kann statt dessen sagen, Kausalität als Realkategorie erzeuge über eine kausal wirksame Selektion Kausalität als Denkform. Das ist dann keine lebensweltliche Erfahrung. I 318 VsEE: sagt überhaupt nichts Neues! Schon Spencer wurde widerlegt. Bei Haeckel findet sich schon die Bezeichnung "biologische Erkenntnistheorie". Die These vom Verstand als Organfunktion erinnert an die Kant Interpretation bei Helmholtz und F.A. Lange: „Das Apriori als physisch psychische "Organisation". Vollmer I 313 Vernunft/BaumgartnerVsVollmer: kann nicht aus sich selbst heraustreten. Sie ist in diesem Sinne absolut und nicht hintergehbar. Vernunft/ZimmerliVsVollmer: das Auge kann sich durch Apparaturen selbst sehen. Aber das Sehen kann es niemals sehen, da es ja immer schon das Sehen vollzieht. "Geistige Unschärferelation". Erklärung/HayekVsVollmer: kein System kann sich selbst erklären. I 314 Rückbezüglichkeit/Hövelmann: das Sprachvermögen ist prinzipiell unhintergehbar. VollmerVsVs: diese Autoren erklären "Vernunft" usw. überhaupt nicht. Ausnahme: I 323 Def Erklärung/Hayek: erfordert Klassifikation. Ein System, das Objekte nach n Merkmalen klassifizieren soll, muss mindestens 2 hoch n verschiedene Klassen bilden und unterscheiden können. Also muss das klassifizierende System wesentlich komplexer sein. Kein System kann sich aber selbst an Komplexität übertreffen, und also auch nicht selbst erklären. I 314 Rückbezüglichkeit/Vollmer: natürlich können Selbsterkenntnis und Selbsterklärung kein sicheres oder vollständiges Wissen vermitteln. Aber viele "gute Zirkel" sind durchaus konsistent und informativ. Bsp "Gute Zirkel": + I 314 |
Putnam I Hilary Putnam Von einem Realistischen Standpunkt In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Frankfurt 1993 Putnam I (a) Hilary Putnam Explanation and Reference, In: Glenn Pearce & Patrick Maynard (eds.), Conceptual Change. D. Reidel. pp. 196--214 (1973) In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (b) Hilary Putnam Language and Reality, in: Mind, Language and Reality: Philosophical Papers, Volume 2. Cambridge University Press. pp. 272-90 (1995 In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (c) Hilary Putnam What is Realism? in: Proceedings of the Aristotelian Society 76 (1975):pp. 177 - 194. In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (d) Hilary Putnam Models and Reality, Journal of Symbolic Logic 45 (3), 1980:pp. 464-482. In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (e) Hilary Putnam Reference and Truth In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (f) Hilary Putnam How to Be an Internal Realist and a Transcendental Idealist (at the Same Time) in: R. Haller/W. Grassl (eds): Sprache, Logik und Philosophie, Akten des 4. Internationalen Wittgenstein-Symposiums, 1979 In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (g) Hilary Putnam Why there isn’t a ready-made world, Synthese 51 (2):205--228 (1982) In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (h) Hilary Putnam Pourqui les Philosophes? in: A: Jacob (ed.) L’Encyclopédie PHilosophieque Universelle, Paris 1986 In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (i) Hilary Putnam Realism with a Human Face, Cambridge/MA 1990 In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam I (k) Hilary Putnam "Irrealism and Deconstruction", 6. Giford Lecture, St. Andrews 1990, in: H. Putnam, Renewing Philosophy (The Gifford Lectures), Cambridge/MA 1992, pp. 108-133 In Von einem realistischen Standpunkt, Vincent C. Müller Reinbek 1993 Putnam II Hilary Putnam Repräsentation und Realität Frankfurt 1999 Putnam III Hilary Putnam Für eine Erneuerung der Philosophie Stuttgart 1997 Putnam IV Hilary Putnam "Minds and Machines", in: Sidney Hook (ed.) Dimensions of Mind, New York 1960, pp. 138-164 In Künstliche Intelligenz, Walther Ch. Zimmerli/Stefan Wolf Stuttgart 1994 Putnam V Hilary Putnam Vernunft, Wahrheit und Geschichte Frankfurt 1990 Putnam VI Hilary Putnam "Realism and Reason", Proceedings of the American Philosophical Association (1976) pp. 483-98 In Truth and Meaning, Paul Horwich Aldershot 1994 Putnam VII Hilary Putnam "A Defense of Internal Realism" in: James Conant (ed.)Realism with a Human Face, Cambridge/MA 1990 pp. 30-43 In Theories of Truth, Paul Horwich Aldershot 1994 SocPut I Robert D. Putnam Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community New York 2000 Vollmer I G. Vollmer Was können wir wissen? Bd. I Die Natur der Erkenntnis. Beiträge zur Evolutionären Erkenntnistheorie Stuttgart 1988 Vollmer II G. Vollmer Was können wir wissen? Bd II Die Erkenntnis der Natur. Beiträge zur modernen Naturphilosophie Stuttgart 1988 |
Der gesuchte Begriff oder Autor findet sich in folgenden 3 Thesen von Autoren des zentralen Fachgebiets.
| Begriff/ Autor/Ismus |
Autor |
Eintrag |
Literatur |
|---|---|---|---|
| Behauptbarkeit | Brandom, R. | II 243 Brandom eigener Ansatz: These regelgeleitetes Sprachspiel, das erlaubt, mit deklarativen Sätzen propositionale Gehalte zu verbinden, die in dem Sinne objektiv sind, daß sie sich von den Einstellungen der Sprecher ablösen - das spaltet die Behauptbarkeit in zwei Teile: Festlegung und Berechtigung (zwei normative Status) - geht über BT hinaus, weil es die Unterscheidung von richtigem und falschem Gebrauch ermöglicht. (>Dummett, >Schach, Witz, Gewinn) |
|
| Wahrheitskriterium | Dummett, M. | III 17/18 Wahrheitskriterium/WK/Kriterium/Dummett: die These daß es kein Kriterium der Wahrheit geben kann ist mittlerweile Gemeinplatz. Grund: wir bestimmen den Satzsinn über die Wahrheitsbedingungen so daß wir nicht zuerst den Sinn des Satzes kennen und dann ein Kriterium anwenden können. Genauso: es gibt kein Kriterium für Gewinn beim Spiel, weil das beim Lernen des Spiels mitgelernt wird. |
|
| Haecceitismus | Lewis, D. | Schw I 104 Def Quidditismus/Schwarz: die These, daß fundamentale Eigenschaften unabhängig sind von ihren kausal-nomologischen Rollen. Er ähnelt dem Def Haecceitismus: dem zufolge die Identität von Einzeldingen nicht durch ihre qualitativen Eigenschaften bestimmt ist. Ihm zufolge können sich qualitativ identische mögliche Welten darin unterscheiden, ob Humphrey in ihnen Gewinnt oder nicht. Quidditismus: These: Bsp nomologisch-strukturell identische Welten können sich darin unterscheiden, welche Rolle Ladung in ihnen Spielt. |
|