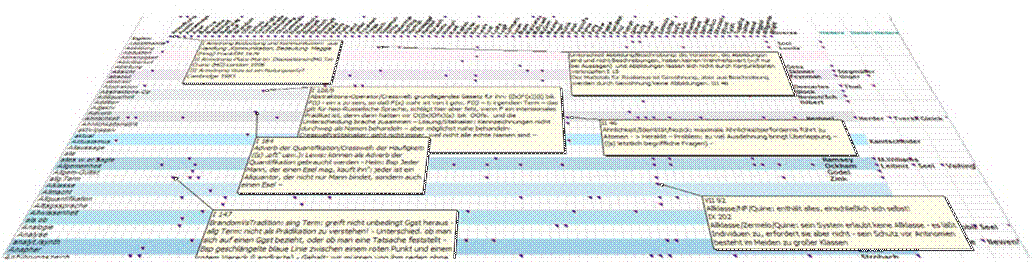Finden Sie Gegenargumente, in dem Sie NameVs…. oder….VsName eingeben.
Der gesuchte Begriff oder Autor findet sich in folgenden 5 Einträgen:
| Begriff/ Autor/Ismus |
Autor |
Eintrag |
Literatur |
|---|---|---|---|
| Konsens | Deliberative Demokratie | Gaus I 160 Konsens/Deliberative Demokratie/Bohman: Für einige Befürworter der deliberativen Demokratie bietet eine starke Unterscheidung zwischen vernünftiger Argumentation und bloßer Diskussion die Grundlage für die Behauptung, dass die Deliberation am Konsens orientiert sein muss (Habermas, 1996(1); Cohen, 1997(2)). Deliberation ist nicht nur Diskurs oder Dialog, argumentiert Cohen, denn sie muss "vernünftig" sein, d.h. auf "öffentlichem Argumentieren und Argumentieren unter gleichberechtigten Bürgern" basieren, die die einzig beste Antwort ergeben (1997(2): 74). VsHabermas/VsCohen: Kritiker werfen oft vor, dass diese beiden Behauptungen ausgrenzend sind und zu undemokratischen Konsequenzen unter dem Gaus I 161 Umstand der Ungerechtigkeit im Hintergrund und der allgegenwärtigen Ungleichheiten führen. Es mag den Anschein haben, dass eine Orientierung am Konsens keine Voraussetzung für eine Deliberation ist, auch wenn sie als regulatives Ideal funktionieren mag. Die Deliberation muss zumindest insofern der Argumentation ähneln, als es darum geht, Gründe zu nennen und nach ihnen zu fragen. Die Gründe, die eine Entscheidung akzeptabel machen, sind von den Formen zu unterscheiden, mit denen sie mitgeteilt werden. Demokratische Standards, die für Entscheidungen gefordert werden, müssen nicht für das Kommunikationsmedium als solches gelten, und nicht alle formellen öffentlichen Sphären müssen idealerweise inklusiv sein. Das bedeutet, dass formale Kommunikations- und Rationalitätstheorien nicht von vornherein genau entscheiden können, welche Kommunikationsmodi und -formen in verschiedenen Settings empirisch angemessen sind. >Deliberative Demokratie/Dryzek, vgl. >Argumentation/Crosswhite. Gaus I 161 Bohman: (...) Uneinigkeit ist genau das, was demokratische Deliberation nicht nur notwendig, sondern auch fruchtbar und produktiv macht, wenn sie durch die Vielfalt der Perspektiven getestet wird, die für ein vielfältiges und pluralistisches Publikum typisch ist. Der argumentative Diskurs muss nicht Einstimmigkeit voraussetzen oder Konsens suchen, sondern stellt Konflikte in einen gemeinsam konstruierten Begründungsraum. >Argumentation/Crosswhite. Diese Tatsache der Uneinigkeit wirft die Frage auf, ob die öffentliche Deliberation "auf Konsens ausgerichtet" ist oder nicht. Konsens ist hier als Gegensatz zur bloßen Aggregation von Präferenzen bei der Abstimmung und zu Verhandlungen oder Kompromissen gemeint. Sicherlich würde es der Demokratie, wenn sie nur wählen und verhandeln würde, an der selbstkritischen Prüfung und Reaktionsfähigkeit der Vernunft und des Diskurses mangeln; die Probleme der Tyrannei der Mehrheit und die Probleme der Aggregation sozialer Entscheidungen würden die Wirksamkeit der Gaus I 162 Demokratie und ihr Anspruch auf Ligitimität untergraben. >Konsens/Diskurstheorien. 1. Habermas, Jürgen (1996) Between Facts and Norms. Cambridge, MA: MIT Press. 2. Cohen, Joshua (1997) 'Deliberation and democratic legitimacy'. In J. Bohman and W. Rehg, (Hrsg.), Deliberative Democracy. Cambridge, MA: MIT Press. Bohman, James 2004. „Discourse Theory“. In: Gaus, Gerald F. & Kukathas, Chandran 2004. Handbook of Political Theory. SAGE Publications |
Gaus I Gerald F. Gaus Chandran Kukathas Handbook of Political Theory London 2004 |
| Konsens | Diskurstheorien | Gaus I 160 Konsens/Deliberative Demokratie/Diskurstheorien/Bohman: Für einige Befürworter der deliberativen Demokratie ist eine starke Unterscheidung zwischen vernünftiger Argumentation und bloßer Diskussion die Grundlage für die Behauptung, dass die Deliberation am Konsens orientiert sein muss (Habermas, 1996(1); Cohen, 1997(2)). Deliberation ist nicht nur Diskurs oder Dialog, argumentiert Cohen, denn sie muss "vernünftig" sein, d.h. auf "öffentlichem Argumentieren und Argumentieren unter gleichberechtigten Bürgern" basieren, die die einzig beste Antwort ergeben (1997(2): 74). VsHabermas/VsCohen: Kritiker werfen oft vor, dass diese beiden Behauptungen ausgrenzend sind und zu undemokratischen Konsequenzen unter dem Gaus I 161 Umstand der Ungerechtigkeit im Hintergrund und der allgegenwärtigen Ungleichheiten führen. Es mag den Anschein haben, dass eine Orientierung am Konsens keine Voraussetzung für eine Deliberation ist, auch wenn sie als regulatives Ideal funktionieren mag. Die Deliberation muss zumindest insofern der Argumentation ähneln, als es darum geht, Gründe zu nennen und nach ihnen zu fragen. Die Gründe, die eine Entscheidung akzeptabel machen, sollten von den Arten unterschieden werden, in denen sie mitgeteilt werden. Demokratische Standards, die für Entscheidungen gefordert werden, müssen nicht für das Kommunikationsmedium als solches gelten, und nicht alle formellen öffentlichen Sphären müssen idealerweise inklusiv sein. Das bedeutet, dass formale Kommunikations- und Rationalitätstheorien nicht von vornherein genau entscheiden können, welche Kommunikationsmodi und -formen in verschiedenen Settings empirisch angemessen sind. >Deliberative Demokratie/Dryzek. Gaus I 162 Habermas: Habermas meint, dass die Teilnehmer an der Argumentation vom Ideal von einer einzigen richtigen Antwort geleitet werden müssen, der alle "aus den gleichen Gründen" zustimmen (1996(1): Kap. 8; Bohman und Rehg, 1996)(3). VsHabermas: Er mag durchaus Recht haben, dass eine allzu agonistische Konzeption des öffentlichen Diskurses die epistemische Grundlage für Ansprüche auf demokratische Legitimität untergraben würde, d.h. dass demokratische Beratung legitim ist und nicht nur ein fairer Prozess ist, sondern eher das gerechteste und wahrhaftigste Ergebnis finden wird (Estlund, 1997)(4). Trotz all ihrer Anziehungskraft auf Kritiker der Deliberation ist die agonistische Debatte nicht weniger offen für den Vorwurf des Elitismus (Benhabib, 1991)(5) und noch weniger auf die Art der Zusammenarbeit ausgerichtet, die zur gegenseitigen Konfliktlösung erforderlich ist. >Argumentation/Crosswhite. 1. Habermas, Jürgen (1996) Between Facts and Norms. Cambridge, MA: MIT Press. 2. Cohen, Joshua (1997) 'Deliberation and democratic legitimacy'. In J. Bohman and W. Rehg, eds, Deliberative Democracy. Cambridge, MA: MIT Press. 3. Bohman, James and William Rehg (1996) 'Discourse and democracy: the formal and informal bases of democratic legitimacy'. The Journal of Political Philosophy, 4 (l): 79_99. 4. Estlund, David (1997) 'Beyond fairness and deliberation: the epistemic dimension of democratic authority'. In J. Bohman and W. Rehg, eds, Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics. Cambridge, MA: MIT Press. 5. Benhabib, Seyla (1991) Situating the Self London: Routledge. Bohman, James 2004. „Discourse Theory“. In: Gaus, Gerald F. & Kukathas, Chandran 2004. Handbook of Political Theory. SAGE Publications |
Gaus I Gerald F. Gaus Chandran Kukathas Handbook of Political Theory London 2004 |
| Konsens | Konstitutionelle Ökonomie | Parisi I 205 Konsens/Information/Unwissenheit/Konstitutionelle Ökonomie/Voigt: Die Möglichkeit einer hypothetischen Zustimmung hängt entscheidend von den Informationsannahmen ab. a) Buchanan und Tullock (1962(1), S. 78) führten den Schleier der Ungewissheit ein, bei dem das Individuum keine langfristigen Vorhersagen über seine zukünftige sozioökonomische Position machen kann. b) John Rawls' (1971)(2) Schleier der Unwissenheit ist radikaler, weil die zustimmenden Individuen aufgefordert werden, über vorgeschlagene Regeln so zu entscheiden, als ob sie kein Wissen über ihr individuelles Schicksal hätten. Rawls' Schleier ist daher anspruchsvoller für die Individuen. Beide Schleier gehen von einer recht merkwürdigen Asymmetrie in Bezug auf bestimmte Arten von Wissen aus: Einerseits sollen die Bürger sehr wenig über ihre eigene sozioökonomische Position wissen, andererseits sollen sie über eine konsistente Theorie bezüglich der Funktionseigenschaften alternativer Verfassungsregeln verfügen. In einem Aufsatz über "veilonomics" vergleicht Voigt (2015)(3) die beiden Schleier und weist darauf hin, dass Rawls' Schleier dazu dient, substantielle Prinzipien abzuleiten, während Buchanans Schleier einem prozeduralen Zweck dient, nämlich die Chance zu verbessern, dass Gesellschaften bei ihrer Verfassungswahl Einstimmigkeit erzielen. >Staatliche Strukturen/Konstitutionelle Ökonomie, vgl. >Justizwesen/Konstitutionelle Ökonomie, >Föderalismus/Konstitutionelle Ökonomie, >Direkte Demokratie/Konstitutionelle Ökonomie. 1. Buchanan, J. M. and G. Tullock (1962). The Calculus of Consent - Logical Foundations of Constitutional Democracy. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press 2. Rawls, John (1971). A Theory of Justice. Cambridge: Belknap. 3. Voigt, S. (2015). "Veilonomics: On the Use and Utility of Veils in Constitutional Political Economy," in: Louis M. Imbeau & Steve Jacob (eds). Behind a Veil of Ignorance? Power and Uncertainty in Constitutional Design. Heidelberg: Springer, pp. 9-33. Voigt, Stefan. “Constitutional Economics and the Law”. In: Parisi, Francesco (Hrsg.) (2017). The Oxford Handbook of Law and Economics. Bd. 1: Methodology and Concepts. NY: Oxford University |
Parisi I Francesco Parisi (Ed) The Oxford Handbook of Law and Economics: Volume 1: Methodology and Concepts New York 2017 |
| Konsens | Morris | Gaus I 204 Konsens/Staat/Legitimität/Morris: Zustimmung ist von Konsens oder allgemeiner Zustimmung zu unterscheiden. >Verständigung/Habermas. Die meisten Formen der politischen Organisation hängen bis zu einem gewissen Grad von Konsens oder Zustimmung ab. Letztere haben jedoch weitgehend mit gemeinsamen Überzeugungen (oder Werten) zu tun. Manchmal werden Begriffe wie diese verwendet, um mehr anzudeuten, aber sie beziehen sich im Wesentlichen auf Übereinstimmung in Glauben oder Gedanken (oder Werten).* Zustimmung/Morris: Im Gegensatz dazu beinhaltet die Zustimmung das Eingehen eines Willens oder einer Verpflichtung. Etwas gilt nur dann als Zustimmung, wenn es sich um eine bewusste Verpflichtung handelt. Im Idealfall handelt es sich um eine Handlung der Zustimmung, wenn es sich um die bewusste und wirksame Kommunikation einer Absicht handelt, eine Veränderung der eigenen normativen Situation (d.h. der eigenen Rechte oder Pflichten) herbeizuführen. >Zustimmung/Morris. * Eine Zustimmung in diesem Sinne sollte auch von der "Billigungszustimmung" (engl. endorsement consent) in Hampton (1997(1): 94-7) unterschieden werden. 1. Hampton, Jean (1997) Political Philosophy. Boulder, CO: Westview. Morris, Christopher W. 2004. „The Modern State“. In: Gaus, Gerald F. & Kukathas, Chandran 2004. Handbook of Political Theory. SAGE Publications |
Gaus I Gerald F. Gaus Chandran Kukathas Handbook of Political Theory London 2004 |
| Konsens | Waldron | Gaus I 91 Konsens/Absprache/Liberalismus/Waldron: Man kann die Idee eines sich "überschneidenden Konsenses" hervorheben - eine Vielzahl von Rechtfertigungspfaden von unterschiedlichen philosophischen Prämissen zu einem Plateau liberaler Prinzipien. (Dies ist die Ansicht von Rawls (...).) Ein anderer kann sich für einen Ansatz des "kleinsten gemeinsamen Nenners" entscheiden, bei dem rechtfertigende Prämissen betont werden, die von allen Mitgliedern einer pluralistischen Gesellschaft unabhängig von den Unterschieden in ihrer Ethik oder Weltanschauung angenommen werden können. Und die Formulierung "kann als akzeptiert vorausgesetzt werden" kann auf verschiedene Weise beschönigt werden, von der Idee allgemein zugänglicher Gründe und Argumentation bis hin zu einer ziemlich aggressiven Darstellung grundlegender menschlicher Interessen, wie die von Hobbes (1991)(1) entwickelte Überlebensstrategie. >Überlappender Konsens/Rawls, >Überlappender Konsens/Waldron. 1. Hobbes, Thomas (1991 [1651]) Leviathan, ed. Richard Tuck. Cambridge: Cambridge University Press. Waldron, Jeremy 2004. „Liberalism, Political and Comprehensive“. In: Gaus, Gerald F. & Kukathas, Chandran 2004. Handbook of Political Theory. SAGE Publications. |
Gaus I Gerald F. Gaus Chandran Kukathas Handbook of Political Theory London 2004 |
Der gesuchte Begriff oder Autor findet sich in folgenden Thesen von Autoren angrenzender Fachgebiete:
| Begriff/ Autor/Ismus |
Autor |
Eintrag |
Literatur |
|---|---|---|---|
| Wissenschaft | Medawar, P. | Anne-Kathrin Reulecke (Hg) Fälschungen Frankfurt 2006 S. 37 Wissenschaft/Theorie/Medawar: These: Das Genre des Wissenschaftsartikels ist per se verfälschend, weil induktiv und funktional-argumentativ. Stattdessen: "Chronologisch-autobiographischer Erzählstil". Di TrocchioVsKonstruktivismus (i. d. Wissenschaft): auch er kann die wissenschaftliche Fälschung nicht fassen: weil er von einem konsensuell hergestellten Wahrheitsbegriff ausgeht. Dann stellen Fälschungen keinen besonders konturierten Sonderfall dar. |
|